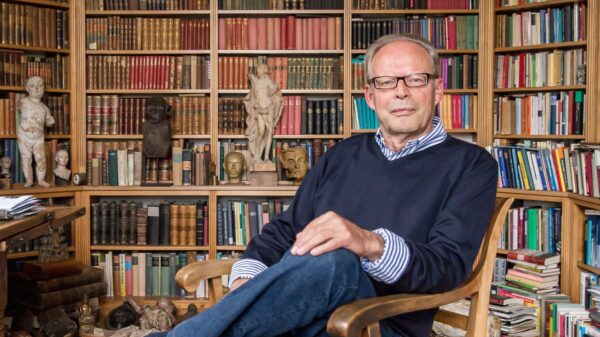Gemeinsinn: die Res Publica

Die Covid-Krise hat unserem Individualismus Grenzen gesetzt. Freiheiten wurden eingeschränkt. Wir mussten uns einem übergeordneten Ziel unterordnen: der Bekämpfung der Pandemie. Die Egoismen und der Gemeinsinn in unserer Gesellschaft sind Gegenstand hitziger Diskussionen geworden.
Auch Unternehmen und Vereine kennen Egoismus und Gemeinsinn. Das Stichwort «Selbstbedienungsladen» trifft auf manche Organisationen zu.
Ob Staat, Unternehmen oder Verein: Je nachdem, ob die Mitglieder mehrheitlich ihren eigenen Nutzen oder den Gemeinsinn vor Augen haben, kennen diese Organisationen unterschiedliche Schicksale. Für Leader ist es deshalb entscheidend, das Thema «Eigennutzen vs. Gemeinsinn» bewusst zu reflektieren.
Die römische Republik
Als Leitgedanke wähle ich die Republik (Latein: «Res Publica», d. h. die gemeinsame Sache) nach Marcus Tullius Cicero. Cicero war ein passionierter Anwalt und Staatsmann in der späten römischen Republik. Er kämpfte gegen die Ambitionen potenzieller Alleinherrscher. In seinem Buch De Re Publica, Band I, schrieb er: «Es ist also [...] ein Staat die Sache des Volkes; Volk aber ist nicht jede beliebig zusammengewürfelte Anhäufung von Menschen, sondern der Zusammenschluss einer grösseren Zahl, die durch eine einheitliche Rechtsordnung und ein gemeinsames Staatsziel zu einer Gesellschaft wird.»
Sein Postulat war recht einfach: Ein Staat (und im Kopf dieses Römers gab es nur einen Staat: Rom, Herrscherin der bekannten Welt um das Mittelmeer) ist mehr als die Summe der Einzelinteressen. Er existiert durch Regeln und v. a. durch ein Ziel: den Gemeinsinn.
Ciceros Aussage ist nicht zufällig, sondern aus historischen Überlegungen gewählt. Die römischen Institutionen waren bis zum Beginn des I. Jahrhundert v. Chr. stabil und vom Gemeinsinn geprägt. Die Aufopferung war eine zelebrierte Tugend. Diese sollte aber mit zunehmendem Wohlstand dem Egoismus weichen. Cicero selbst erlebte den Beginn dieser Wende. Im kaiserlichen Zeitalter war die militärische Macht zunächst noch vorhanden, doch leisteten die Römer immer weniger Dienst an der Allgemeinheit. Am Schluss mussten Römer gar durch Germanen vor anderen Germanen geschützt werden. Der Gemeinsinn schwand, und damit auch bald das einst so mächtige Römische Reich.
Gemeinsinn in Organisationen
Den Gedanken vom Staatsziel und von Gemeinsinn nach Cicero können wir auf Organisationen wie Unternehmen oder Vereine wie folgt übertragen.
Eine Organisation gedeiht, wenn deren Mitglieder mehr in sie investieren, als sie von dieser Organisation objektiv beziehen.
Beispielsweise zeichnen sich erfolgreiche Vereine dadurch aus, dass viele Mitglieder sich einbringen und nicht nur der Vorstand. Sie helfen an Anlässen mit, erledigen die eine oder andere Arbeit unentgeltlich usw. Besteht der Beitrag der Mitglieder jedoch mehrheitlich in der Zahlung des jährlichen Obolus und diejenige des Vorstandes in der Teilnahme an Vorstandssitzungen, zerfällt der Verein früher oder später.
In grösseren Unternehmen sind Selbstbedienungsmentalitäten leider nicht unüblich. Ein guter Indikator ist die Zunahme von Nebenleistungen und Lohnbestandteilen mit dem hierarchischen Rang: Wenn diese Mentalität ganz oben fest verankert ist, ist es nicht weiter erstaunlich, dass Mitarbeiter jedes Mittagessen auf die Spesenabrechnung nehmen. Das hat mit Gemeinsinn nichts mehr zu tun: Die «Reason why» im Unternehmen ist, dass sich jeder die Taschen möglichst füllen sollte. Auch im spätkaiserlichen Rom war diese Haltung weit verbreitet, mit verheerenden langfristigen Folgen.
Wo sind die Vorteile?
Eine Organisation lebt also davon, wieviel ihre Mitglieder zu ihrem Gedeihen beitragen – in Arbeit, Geld oder Energie. Aber warum sollten die Mitglieder mehr in die Organisation investieren, als sie objektiv beziehen? Weil sie subjektiv mehr erhalten – durch die Teilnahme an einem grösseren Ziel. Wir sind beim «Purpose» einer jeden Organisation angelangt.
Wenn ich an einer grösseren Sache arbeite, bekomme ich objektiv vielleicht finanzielle Vorteile oder sonstige Leistungen von dieser Organisation. Aber subjektiv weiss ich eben, dass ich zu einer guten Sache beitrage. Die Summe von subjektiv und objektiv macht meinen Nutzen aus. Und der verdeckte, subjektive Teil wiegt oft deutlich schwerer als der objektive, quantifizierbare Teil. Dieser subjektive Teil ist der Gemeinsinn.
Auch interessant
Leader und Gemeinsinn
Was können Leader in ihrer jeweiligen Organisation – ob Staat, Unternehmen oder Verein – mit diesen Gedanken bewirken? Wenn man sich den soeben skizzierten republikanischen Gedanken vor Augen hält, haben Leader zwei primäre Funktionen.
Erstens sind sie dafür verantwortlich, die gemeinsame Sache zu identifizieren, zu benennen und das Verhalten der Organisation danach zu richten. Sie müssen den Gemeinsinn beleben.
Zweitens müssen Leader etwas tun, was in einer liberalen Gesellschaft höchst unpopulär geworden ist: sich selbst dem Gemeinsinn unterordnen. Wenn ich mich als Leader an allen Ecken und Enden im Unternehmen bediene, muss ich keinen ausgeprägten Gemeinsinn von meinen Mitarbeitenden erwarten. Selbstlosigkeit unterstützt den Gemeinsinn und ist aus dieser Perspektive heraus eine empfehlenswerte Tugend.