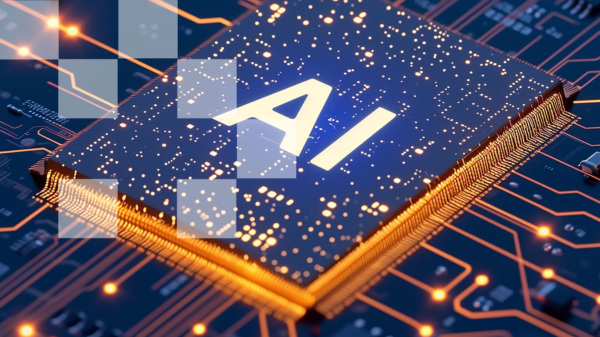Dem langen Leben Sinn geben

Sabina Misoch, Sie erforschen Alter in all seinen Dimensionen – dann können Sie ja sicher auch sagen, wann man eigentlich alt ist.
Alter fängt, zumindest sozialpolitisch, mit dem Rentenalter, in der Schweiz also mit 64 bzw. 65 Jahren an Und dauert bis zum Lebensende. In jedem Fall ist es eine extrem lange Lebensphase, die mehrere Jahrzehnte umfasst und die sehr viele verschiedene Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen beinhaltet.
«Das Geheimnis für Langlebigkeit ist aktiv bleiben.»
All diese Herausforderungen erforschen Sie?
Wir erforschen alles, was mit Alter und Altern zusammenhängt. Das ist ein riesiger Themenfächer und unglaublich spannend, weil es eine lange und bunte Lebensphase ist, von sehr fitten Seniorinnen und Senioren bis hin zu Menschen, die schon am Abschied nehmen sind. Es gibt Herausforderungen sozialer, psychischer und physischer Natur. Ein Thema, das wir aktiv erforschen: Was passiert mit mir, wenn ich in die Nacherwerbsphase gehe? Was passiert mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Identität, muss ich mich da anpassen? Diese Frage stellt sich insbesondere für Männer, die sich vorher stark über den Beruf definiert hatten. Das fällt nun von heute auf morgen weg – in der Lebensphase Alter geht es deshalb auch darum, neue Sinninhalte zu finden.
Und verlorene Kräfte zu kompensieren.
Im Alter wird man physisch gebrechlicher, man ist gegebenenfalls kognitiv nicht mehr fit oder ist mobilitätseingeschränkt – und man muss lernen, damit umzugehen. Dafür gibt es auch technologische Unterstützung. Die Frage ist: Will man die? Es kommt auch zur Verkleinerung sozialer Ressourcen, was vor allem bei hochaltrigen Menschen ein Problem ist: Wenn Freunde sterben ist man irgendwann relativ einsam. Es gibt wirklich unglaublich viele Themen für die Altersforschung, bis hin zu Palliativ Care und gutem Sterben.
Sie selbst erforschen aber die Langlebigkeit.
Ja, ich möchte herausfinden, welche Faktoren, die nicht medizinischer oder genetischer Natur sind, Langlebigkeit begünstigen.
Ist Langlebigkeit per se ein erstrebenswertes Ziel?
In unserer Gesellschaft schon. Das Paradoxe ist ja: alt werden will jeder, alt sein will niemand. Die Menschen wünschen sich, möglichst lange mit möglichst hoher Lebensqualität zu leben.
Wie suchen Sie nach neuen Erkenntnissen?
Es gibt Regionen in der Welt, in denen Menschen extrem lange und mit hoher Lebensqualität leben. Eine dieser Regionen ist das Dorf Ogimi auf der japanischen Inselgruppe Okinawa. Da leben weltweit am meisten Hundertjährige. Vor der Pandemie war ich mehrmals zu Forschungszwecken dort. Ich versuche herauszufinden, welche Faktoren entscheidend sind – psychosoziale Faktoren, die Langlebigkeit unterstützen.
Diese Erkenntnisse gelten nicht für ganz Japan, sondern für diesen kleinen Ort?
Ja. Es ist eine kleine Insel, auf der die langlebigsten Menschen der Welt wohnen – auch dort sind es fast nur Frauen. Männer sterben auch hier früher. Die Lebenserwartung dort wie bei uns ist nach Geschlechtern verteilt unterschiedlich. Das wird sich irgendwann angleichen, aber noch ist es so, dass Frauen deutlich länger leben als Männer. Deshalb gilt die Lebensphase Alter als feminisiert.
Sie haben diese Insel besucht und erforscht: Die Menschen dort sind nicht nur langlebig, sondern auch glücklich?
Ja. Und gesund! Es gibt ein Treffen der alten Menschen in einem Gemeindezentrum, da darf man ab 65 plus kommen. Es kommen die 90 plus, sie sitzen zusammen, essen, tanzen, machen Gymnastik. Als ich dort war, hat eine 94-jährige Dame mich zum Tanz aufgefordert. Sie ist mit einer unglaublichen Energie übers Parkett gefetzt. Ich bin noch lange nicht 94, aber da konnte ich nicht mithalten! Die Menschen sind sehr zufrieden mit ihrem Leben, was auch mit einem anderen Mindset zu tun hat.
Und mit einem gewissen Wohlstand? Japan ist ein reiches Land.
Die Menschen auf Okinawa sind materiell sehr arm und leben in einfachen Verhältnissen. Ein Stück weit eine vor-moderne Gesellschaft, viele bauen ihre Früchte und ihr Gemüse selbst an. Die alten Leute haben zudem kein einfaches Leben, haben die Schlacht um Okinawa im Zweiten Weltkrieg noch miterlebt, haben dort ihre Partner oder Familienangehörige verloren. In der Gegenwart erleben sie jedes Jahr etliche Taifune, die viel zerstören.
Auch interessant
«Auf jeden Fall ist die Technisierung in der Pflege ein ganz heisses Thema.»
Also kann man in einem entbehrungsreichen Leben sein Glück finden?
Auf Okinawa leben Menschen, die sehr in sich ruhen und zufrieden sind. Sie haben auch einen tiefen Glauben. Frauen, mit denen ich gesprochen habe, führen am Morgen, wenn sie aufstehen, als erstes ein Zweigespräch mit den Ahnen. Sie teilen ihnen Leid und Kummer mit – so etwas hilft vermutlich auch bei der Stressreduktion. Und: Alle Menschen sind sozial sehr gut eingebunden.
Was bewirkt das?
Einsamkeit im Alter, was bei uns ein grosses Problem ist, ist dort kein Thema. Das sind kleine Gemeinschaften, in denen jeder mitgenommen wird. Das sieht man auch bei Treffen im Community Center von Ogimi: Wenn Akiyama nicht auftaucht, fragt man sich: Was ist mit ihr, warum war sie nicht da? Und geht nachschauen. Auch wenn jemand krank ist, bringen die anderen Essen vorbei. Ich bin noch nicht am Ende meiner Forschungen, ich wollte letzten Sommer wieder nach Japan reisen, das ging aufgrund der Pandemie nicht, diesen Sommer vereitelt Corona meine Pläne nun ebenfalls. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr meine Forschungen wieder aufnehmen kann und herausfinde, welches die sozialpsychologische Faktoren sind, die Langlebigkeit begünstigen.
Einen interessanten Punkt haben Sie schon genannt: Wir reden nicht vom High-Tech-Japan, sondern von einer ländlichen, zurückgebliebenen und armen Region. Kann denn Genügsamkeit ein Faktor sein?
Das ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall ist eine innere Zufriedenheit mit dem Leben, so wie es ist, kein falscher Ansatz für ein gutes Altern.
Welche Faktoren stehen den schon fest?
Ein Faktor ist sicher die gute soziale Einbindung. Des Weiteren Aktivität: Eine Frau, die in einem Lädeli Verkäuferin ist, macht einfach weiter und sitzt in dem Laden, bis sie 100 ist. Oder zumindest bleibt sie aktiv, bis sie nicht mehr kann. Das Geheimnis für Langlebigkeit ist aktiv bleiben. Dadurch hat das Leben immer auch einen Sinn. In Japanisch gibt es dafür den Begiff Ikigai, was ungefähr «das, wofür es sich zu leben lohnt» bedeutet. Mit einem klaren Ikigai lebt es sich gut – auch im hohen Alter.
Also ist die psychosoziale Ebene ein wichtiger Faktor?
Ja, das ist zumindest meine These. Bis man das alles belegen kann, geht es noch eine Weile.
Ist diese Erkenntnis denn neu?
Bislang gibt es viele Forschungsansätze zu Langlebigkeit, die auf bestimmte Genkonstellationen, Umweltbedingungen oder das Ernährungsverhalten fokussieren. Das sind sicher auch alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Man hat in der Forschung aber auch festgestellt, dass Langlebigkeit nur zu etwa 25 Prozent auf biologischen Fakten beruht, der Rest ist Lifestyle. Das ist für uns auch eine gute Nachricht, weil wir nun wissen, dass wir hier viel beeinflussen können. Wir können es natürlich auch negativ beeinflussen, indem wir ungesund leben, uns ungesund ernähren, rauchen usw. Das lange Leben ist zum grössten Teil eine Sache des Lifestyles und nicht der Genetik.
Spassbremsen leben also länger? Oder meinen Sie Lifestyle auch im Sinn von positivem Mindset? Ich werde glücklich, wenn ich mich glücklich fühle?
Das eben auch. Zufrieden sein, mit dem, was man hat, schadet nicht. Wir leben in einem solchen Wohlstand, dass wir erst recht zufrieden sein könnten. Wir erleben nicht jedes Jahr 25 Taifune, die den Garten, der unsere Lebensgrundlage ist, zerstören. Spannend finde ich auch, dass die Leute auf Okinawa sehr zukunftsorientiert sind. Ich finde es beeindruckend, eine Hundertjährige zu interviewen, die munter Pläne schmiedet und nicht nur zurückblickt.
Sie haben schon ein ziemlich klares Bild, welche Faktoren für Langlebigkeit entscheidend sind.
Ich bin noch nicht am Ende meiner Forschung, aber die Faktoren, die eine Rolle spielen dürften, sind: Aktiv leben und eingebunden bleiben – nicht unbedingt ausschliesslich in Erwerbsarbeit, aber tätig sein für etwas, dass für die Gemeinschaft sinnstiftend ist. Dann eben auch gesund ernähren, dieser Faktor ist in Ogimi einfach gegeben. Die Menschen dort essen kaum Sachen aus dem Supermarkt, weil sie schlicht das Geld dazu nicht haben. Deshalb bauen sie fast alles selber an. Die Leute bewegen sich viel, sind immer unterwegs in ihrem Dorf, sie pflegen viel Kontakt, sind sozial eingebunden. Umgekehrt sehen wir bei Studien in westlichen Ländern: Ältere Menschen, die einsam sind, sterben früher.
Auch interessant
Sie leiten in der Schweiz ein Netzwerk von unterschiedlichsten Altersforschungsansätzen.
Das sind zwei Grossprojekte. Eines, Age, haben wir Ende März gerade abgeschlossen. Im Januar ist mit Age nun ein neues grosses Verbundprojekt gestartet.
Wer lanciert ein solches Verbundprojekt?
Bei diesen Projekten waren wir es von der OST. Wir haben einen Antrag formuliert, der ans Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, SBFI, geht, und haben Partner-Institutionen eingeladen. Diese Partner bringen ihre jeweiligen speziellen Themenexpertisen mit. Diese Projektgebundenen Beiträge, die vom Bund finanziert werden, werden sehr streng evaluiert und wir freuen uns umso mehr, dass wir den Zuschlag für dieses 7.5 Millionen Franken schwere Verbundprojekt erhalten haben. Geleitet wird dies von der OST aus, ich bin Gesamtprojektleiterin. Auch leite ich zusammen mit meinem Team eines der vier Themen, Technologien für Menschen im Alter.
Ist das nicht ungefähr das Gegenteil dessen, was Sie in Japan geforscht haben?
Aber auch hier sind es wieder die sozial-psychologischen Faktoren die uns interessieren. Schon im Projekt Age hatten wir darauf fokussiert, wie man Technologien entwickeln muss, damit sie Akzeptanz finden bei 65+.
Mit welchem Ergebnis?
Das Zauberwort heisst Partizipation. Man muss wirklich den partizipativen Weg gehen – der zeitintensiv ist, weil die Entwicklung dann natürlich die Integration von Senioren bedeutet: Die Evaluation des Systems durch Senioren, die man dann auch ernst nehmen muss. Aber anders kann man keine Produkte entwerfen, die für Senioren stimmig sind, passen und auf dem Markt dann auch Erfolg haben.
Sie haben also den Rahmen definiert, wie man ein erfolgreiches Produkt entwickeln kann.
Wir haben eine innovatives Testnetzwerk aufgebaut in der gesamten Schweiz, das nennt sich Living Lab 65+, wir haben ein neues Testkonzept entwickelt, und testen dort innovative Produkte in einem frühen Stadium der Produktentwicklung.
Sie erwecken das Labor zum Leben?
Wir machen keine herkömmliche Labortestung. Da gibt man ein Produkt ins Labor, lädt Senioreninnen und Senioren ein, die das ein, zwei Stunden ausprobieren und danach einen Evaluationsbogen ausfüllen. Wir fanden, das greift zu kurz, denn wenn ich ein Produkt einen Moment lang sehe, kann ich nicht sagen, ob ich das wirklich zuhause in meinem Lebensalltag einsetzen würde. Oft gibt es einen gewissen Neuigkeitseffekt, nach drei Tagen lege ich es aber zur Seite und merke, das bringt mir ja gar nichts. Deshalb sagte wir uns, wir müssen langzeitig testen, die Technologie muss zu den Menschen kommen, nicht die Menschen zu den Technologien. Und sie müssen es in ihrem normalen Lebensumfeld testen. Wenn ich das in dem künstlichen Labor mache: Das ist nicht mein zuhause. In meinem Zuhause habe ich spezielle Bedürfnisse, die ich im Labor gar nicht habe. Deshalb haben wir eine Struktur aufgebaut, in der Menschen 65+, die zuhause oder in Institutionen leben, mit uns testen.
Ein «Labor bi de Lüt» quasi.
Wir haben ein grosses Netzwerk in der Schweiz an Personen und Institutionen, die mit uns Produkte partizipativ testen. Sie haben Produkte bis zu sechs Monaten im Einsatz, und das wird dann sozialwissenschaftlich engmaschig von uns begleitet. Am Schluss können wir sagen: Entspricht das überhaupt den Bedürfnissen, von älteren Menschen, ist das Produkt von den Funktionalitäten her so gestaltet, dass es sinnvoll ist, stimmt die Bedienung, passt das Design, findet das die Akzeptanz der Nutzergruppe?
Wie muss das Design sein? Praktisch?
Viele Produkte für ältere Menschen kommen in einem Spital-Look daher. Aber nur weil sie älter werden, verlieren ästhetisch sensible Menschen noch lange nicht ihr Bewusstsein dafür, ob etwas schön ist oder nicht.
Das sind reale Entwicklungen aus der Wirtschaft, die Sie testen. Was darf man sich darunter vorstellen?
Wir haben zum Beispiel Sensorensysteme getestet, weil das gerade für Leute zuhause attraktiv ist: Sensoren, die Wasserüberlauf melden oder Feuer, automatische Lichtleisten, aber auch Sturzmelder. Ein Sensor, der sehr gut ankam, wurde im Kühlschrank verbaut: Wird die Kühlschranktüre 24 Stunden nicht geöffnet, löst er einen Alarm aus. Dieser Alarm geht an eine individuell definierte Liste von Personen. Und weil unsere Testpersonen auch mal etwas anderes als die Sensoren, die eben Basis für viele Innovationen sind, testen wollten, haben wir einen kleinen Roboter zur Bewegungsförderung programmiert. Bewegungsmangel ist ja auch ein Faktor für schlechtes Altern. Das Experiment mit dem Roboter kam recht gut an, zumal jetzt auch eine Generation vorzufinden ist, die recht innovationsoffen ist.
... und was macht denn der Roboter? Tanzt er?
Der «Nao» ist ein sehr beweglicher Roboter, er hat vorgeturnt. Aber ja, er kann auch tanzen, sogar Disco-Style. Wir sehen den Einsatz des Roboters eher in Heimen, für private Haushalte wäre das wohl ein etwas teurer Spass. Aber momentan sind Testungen in Heimen pandemiebedingt nicht möglich.
Zahlen die Firmen, die kommerzielle Produkte entwickeln, etwas für Ihre Forschung?
In den meisten Fällen sind das Forschungsprojekte, oft gefördert von der der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung, Innosuisse. Innosuisseprojekte unterstützen ganz gezielt Innovationsentwicklungen in der Schweiz. Der jeweilige Industriepartner bringt auch auch Geld ein.
Welchen Fragen geht das Forschungsnetzwerk Age sonst noch nach?
Das Projekt dreht sich um verschiedene Aspekte des Alterns in der Gesellschaft. Neben Technologien für Menschen im Alter, das von meinem Institut geleitet wird, betreut die OST auch Forschungen zur Demenz – je länger Menschen leben, desto mehr ist das ein Thema. Ein spannendes Thema leitet die Berner Fachhochschule BFH mit Arbeitsmarkt 65+ bei. Ich habe in Japan gesehen, dass es dort eigene Arbeitsämter für die «Silverworker» gibt. Dort ist Erwerbstätigkeit über 65 für viele ökonomisch notwendig und deswegen auch viel institutionalisierter. Ein vierter Baustein unserer Forschungen bei Age ist Einsamkeit im Alter, das macht die Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, die Fachhochschule Südschweiz. Einsamkeit im Alter ist ein brennendes Problem, und wir haben noch so wenige Lösungen dafür!
Das sind durchwegs Fragen, die sich vielerorts auf der Welt stellen.
Deshalb schauen wir bei allen vier Themen: Was gibt es für Lösungen europaweit, weltweit, und bei welchen Lösungen würde es Sinn machen, sie auf die Schweiz zu übertragen? Wir müssen ja das Rad nicht immer neu erfinden. Wir wollen den Austausch mit internationalen Experten pflegen, was umgekehrt auch uns international mehr in die entsprechenden Forschungs-Communities einbindet.
Wie vernetzt sind die einzelnen Projekte? Gibt es Schnittmengen von fast philosophischen Themen wie Einsamkeit mit Technologie?
Eine Grundidee unseres Verbundprojektes ist, dass nicht separate Themen parallel nebeneinander her bearbeitet werden, sondern dass es Themen sind, die eng miteinander verzahnt sind. Das ist bei Age der Fall. Unsere vier Themenfelder Technologie, Demenz, Erwerbstätigkeit 65+ und Einsamkeit bzw. soziale Inklusion sind miteinander verbunden und Synergieeffekte werden hier an der Tagesordnung sein.
In der Schweiz kann sich gemäss einer aktuellen Umfrage die Hälfte der Beschäftigten vorstellen, nach der Pensionierung zumindest teilweise weiter zu arbeiten. Etliche tun dies auch schon.
Das sind Leute mit grossem Wissen, vor allem Erfahrungswissen, das ich mir als Berufsneuling nicht rasch aneignen kann. Viele Branchen wären froh, wenn diese Menschen nicht von heute auf morgen verschwinden und das Know-how erhalten bliebe. Kann man zum Beispiel einen Kundenberater einer Bank, der seine Kunden schon seit Jahrzehnten begleitet, in einem Teilzeitpensum im Beruf halten, kann dies sehr wertvoll sein. Viele Senioren sagen uns: Wir möchten gerne noch weiter arbeiten, aber sicher nicht zu hundert Prozent.
Wir haben einen Fachkräftemangel.
Und der wird sich noch akzentuieren. Der Arbeitsmarkt 65+ ist auch dafür ein Lösungsansatz.
Fördert das nicht eine zusätzliche Zweiteilung der Gesellschaft? Bei hochqualifizierten Jobs wird eine Weiterbeschäftigung nach 65 sehr gefragt sein. Bei einfachen Jobs ist dies wohl weniger Fall – obwohl bei diesen Berufstätigen der ökonomische Druck höher sein dürfte.
Das ist so. Auf dem Bau arbeiten die meisten nicht einmal bis 65 und wären kaum erfreut, wenn man ihnen anbieten würde, noch länger zu arbeiten. Das wäre jetzt eine Fragestellung für unser Projekt: Können wir für die Schweiz Modelle entwickeln, die nicht Gefahr laufen, dass die soziale Schere nach 65 noch stärker aufgeht?
Können wir das?
Da habe ich noch keine Lösung parat, sonst bräuchten wir ja auch das Projekt nicht. Diese Frage müssen wir wirklich vertieft studieren. Bislang ist es so, dass die Hochqualifizierten weiter arbeiten. Als Anwalt kann ich problemlos bis 70 oder 75 weiterarbeiten. Für die Geringqualifizierten gibt es oft keine Arbeitsmodelle die dies unterstützen würden, und für gewisse Tätigkeiten geht es auch schlicht körperlich nicht mehr.
Wie können Sie allfällige Erkenntnisse aus dem Projekt zurückspielen in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt? Gehen Sie auf Behörden und Verbände los?
Wir gehen auf alle los! Im Ernst: Wir haben gemerkt, dass Vernetzung sehr relevant ist für den Erfolg eines wissenschaftlichen Vorhabens, das gesellschaftlicher Wirkung entfalten will und werden diese bei Age intensiv betreiben.
Was machen Sie dafür?
Ich konnte Alt-Bundesrätin Eveline Widmer Schlumpf gewinnen, sie unterstützt uns im Beirat. Daneben stehen wir mit der parlamentarischen Gruppe für Altersfragen im Austausch und konnten weitere wichtige Persönlichkeiten für unseren Beirat gewinnen. Auch binden wir relevante Stakeholder auf verschiedenen Ebenen in das Projekt aktiv mit ein.
Wie sieht das bei der Wirtschaft aus? Vielleicht entdecken Sie Ansätze, die auch interessante Geschäftsmodelle bergen?
Wir sind jetzt an einem Umbruch, manche Entwickler haben es schon verstanden und sagen sich: Ja, Participatory Design muss sein. Es gibt aber auch noch die alte Schule, im Stil von «wenn unser Ingenieur eine gute Idee hat, dann kommt die zu fliegen, der Markt wird das schon verstehen». Aber der Markt sind die Seniorinnen und Senioren, und diese sind nicht nur kaufkräftig, sondern auch anspruchsvoll.
Die Fachhochschule OST assoziiert man mit Pflegeausbildung. Welche Impacts darauf wird Ihre Forschung haben? Wird sich der Beruf verändern? Haben Pflegende künftig mehr Zeit für menschliche Betreuung, weil andere Dinge technologisch gelöst werden können?
Sie haben die Antwort eigentlich schon gegeben. In einem Projekt, bei dem ein Roboter gemeinsam mit einem Heim entwickelt wird, stellt man genau diese Frage: Welche Tätigkeiten der Pflegenden kann ich auf einen Roboter auslagern, ohne dass die Bewohnerinnen und Bewohner das als unangenehm empfinden? Tätigkeiten wie Dokumente von A nach B bringen gehören nicht zu den Kernaufgaben der Pflege, zu den pflegerischen Tätigkeiten direkt am Menschen. Für andere Tätigkeiten wünschen sich die Bewohnenden zu Recht, dass die Pflegenden das machen und nicht der Roboter. Auf jeden Fall ist die Technisierung in der Pflege ein ganz heisses Thema. Es gibt Sensorsysteme, die Türen steuern und so Zugang gewähren oder verweigern können. Menschen mit Demenz könnten sich damit im ganzen Haus bewegen, mit dem Chip-Armband können sie aber, je nach Stadium der Demenz, nicht die Eingangstüre öffnen. Sie können also nicht weglaufen, sich sonst aber frei bewegen.
Als Senior muss ich akzeptieren, dass ich ein Armband trage und überwacht werde?
Das Bändeli entspricht einem GPS-Tracker. Das muss man wohl akzeptieren, je nach Situation und Notwendigkeit. Bei Menschen mit Demenz sind es ab einem gewissen Stadium die Angehörigen, die sagen es ist okay, wenn ihr mein Mami damit ausstattet. Oder: Es ist nicht okay. Die Frage lautet: Wie viel Monitoring nehmen wir für Sicherheit in Kauf? Das muss jede und jeder für sich entscheiden. Es ist aber möglich, dass manche Heime einst sagen werden: Das ist bei uns Usus, wenn sie nicht damit einverstanden sind, können sie nicht in unser Haus kommen.
Was muss man noch akzeptieren?
Beispielsweise Sturzsensoren. Da gibt es Lösungen mit Kamerasystemen, eine Person in ihrem Zimmer wird dabei permanent aufgenommen, um zu dedektieren, wenn sie stürzt. Das würde ich nicht haben wollen, dass mich den ganzen Tag über jemand filmt. Zumal es dafür auch andere Lösungen gibt, etwa eine Wärmebildkamera. Man sieht nicht, dass auf dem Bildschirm Frau Müller ist, aber man sieht, dass jemand am Boden liegt. Und wenn die Person länger dort liegt und sich nicht mehr bewegt, macht sie wohl kein Yoga, sondern ist gestürzt. Wir fragen uns also: Welche Technologien bieten hohe Sicherheit, agieren aber so im Hintergrund, dass sie nicht als störend empfunden werden.
«Der Markt sind die Senioren, und diese sind nicht nur kaufkräftig, sondern auch anspruchsvoll.»
Was bedeutet das für den Pflegeberuf? Wird das nun ein Ingenieurstudium?
Nein. Aber ein Teil des Studiums wird sich mit Technologien für Menschen im Alter befassen. Bis jetzt ist Technologie in dieser Ausbildung kaum ein Thema, das wird nun bewusst in die Curricula integriert. Oft sind übrigens die Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen gegenüber Technologien offener als die Pflegenden. Wenn man den Senioreninnen und Senioren sagt, dass ihre Sicherheit verbessert und ihre Eigenständigkeit gestärkt wird, sind sie gerne bereit, das zu testen. Die Pflegenden sehen vielleicht erst einmal einen Mehraufwand. Wenn die Pflegenden künftig in der Ausbildung schon sehen, welche Technologien ihnen Vorteile bringen und welche Innovationen nicht, ist das sinnvoll. Es braucht einen bedürfnisorientierten Technologieeinsatz.
Wenn die Technik gewisse Aufgaben übernehmen kann, gewinnt man Zeit, so dass man entweder Stellen einsparen – oder aber den Pflegenden mehr Luft für «menschliche Pflege» geben kann. Haben Sie Einfluss darauf?
Wir versuchen, nur Entwicklungen zu unterstützen, die die Pflege entlasten und dieser somit mehr Möglichkeiten für Qualitätspflege geben. Aber klar, wir können nichts tun, wenn sich hier ein rein ökonomischer Ansatz durchsetzt und die Pflege – trotz technologischer Entlastung – dann genau so wenig Zeit hat wie heute. In der Schweiz haben wir noch Qualitätspflege, die Menschen sollen sich wohl fühlen in einem Heim. Das findet man längst nicht in allen Ländern auf diesem Standard. Es wäre ein Armutszeugnis für die Schweiz, das aufzugeben.
Text: Philipp Landmark
Bild: Marlies Thurnheer