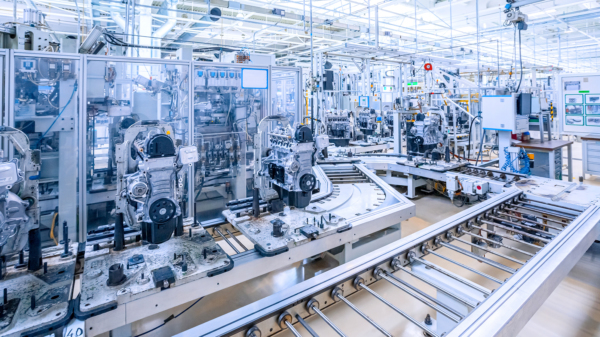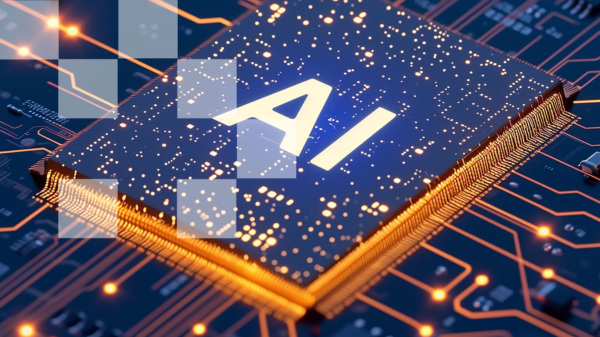«Modularität in kleinem Massstab»

Guido Cozzi, wie funktioniert die digitale Unternehmensfinanzierung?
Sie ermöglicht schnelle und umfassende Dienstleistungen, die von kleinen mobilen Zahlungssystemen bis hin zu ausgefeiltem Portfolioaufbau reichen. Darüber hinaus erweitern innovative Portfolios – die Kryptowährungen, Stablecoins und die künftigen digitalen Währungen der Zentralbanken einbeziehen – die Finanzierungsmöglichkeiten der Unternehmenswelt.
Für welche Unternehmen ist diese Art der Finanzierung geeignet?
Alle Arten von Unternehmen werden daran interessiert sein. Grosse Unternehmen und Unternehmen des Finanzsektors können den Umfang und die Qualität ihrer Aktivitäten verbessern. Dies aber gilt auch für kleine landwirtschaftliche Betriebe, selbst in ländlichen Gegenden. Nehmen wir als Beispiel einen Bauernhof, der Eier an ein Netz lokaler Kunden verkauft: Die Möglichkeit von Twint-Zahlungen kann ihn mehr und mehr von Barzahlungen unabhängig machen. Diese Variante ist sicherer und die Kunden vor Ort müssen nicht immer Bargeld dabeihaben.
Was sind die Hauptunterschiede zur klassischen Bankfinanzierung? Welchen Mehrwert bietet die digitale Unternehmensfinanzierung?
Sie ist schneller, wettbewerbsfähiger und birgt weniger regulatorische und bürokratische Hindernisse. Digitale Plattformen ermöglichen eine Modularität in kleinem Massstab, aber auch eine schnelle Skalierung der Aktivitäten. Sobald ein erfolgreiches Risiko-/Ertragsprofil ermittelt wurde, lassen sich die Möglichkeiten schnell vervielfachen.
«Innovative Portfolios erweitern die Finanzierungsmöglichkeiten der Unternehmenswelt.»
Das erfordert aber neue Kompetenzen und mehr Aufmerksamkeit, da das Risiko einer Fehlentscheidung höher ist.
Das ist richtig. Idealerweise sollten solche Plattformen deshalb auch mit den bestehenden Banken zusammenarbeiten. Banken können die zusätzliche Erfahrung und Sicherheit bieten, die den Unterschied zwischen einem Erfolg und einem Abenteuer ausmachen.
Worauf sollten Unternehmen achten, wenn sie über solche Plattformen Kapital aufnehmen wollen? Wo gibt es möglicherweise Stolpersteine?
Der Umfang der Tätigkeit unterliegt noch normativen Änderungen. Der derzeitige Rechtsrahmen befindet sich noch im Aufbau. Ausserdem kann sich das Wettbewerbsumfeld durch den Eintritt neuer Akteure verändern. Daher würde ich den Unternehmen empfehlen, ihr Personal angemessen zu schulen oder die Dienste kompetenter Personen und Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Der Mangel an hochgradig zuverlässigem Humankapital ist kritisch, weil es in diesem Sektor wenig spezialisierte Ausbildung und angewandtes Learning-by-Doing gibt.
Es braucht also nach wie vor Menschen, um eine digitale Unternehmensfinanzierung mit möglichst wenig Risiken aufzugleisen?
Absolut! Ich möchte die Unternehmen davor warnen, sich nur auf die Unterstützung durch Chatbots oder ähnliche Abkürzungen zu verlassen. Andernfalls könnten sie bereuen, dass sie sich nicht an den traditionellen Bankensektor gewendet haben, um sich besser beraten zu lassen.
Auch interessant
Wie sehr verändern digitale Finanzierungsplattformen das Kreditgeschäft? Sind sie eine ernsthafte Konkurrenz für traditionelle Banken?
Sie stellen eine ernsthafte Konkurrenz für rückwärtsgewandte Banken dar. Allerdings waren einige Schweizer Banken schon immer Vorreiter in Sachen Innovation. Twint zum Beispiel ist aus der Zusammenarbeit von Postfinance, UBS und der Zürcher Kantonalbank hervorgegangen. Anders als man erwarten würde, waren der öffentliche Sektor und die etablierten Banken hier die innovativen Zentren. Deshalb denke ich, dass sie es schaffen werden, auf der Fintech-Welle zu surfen.
Fortschrittsorientierte Banken werden also gewinnen …
Ja, denn die Komplementarität von Innovation und Reife ist der Schlüssel zum Erfolg in einer sich schnell verändernden und turbulenten globalen Wettbewerbsarena. Daher wer-den wir eine Auswahl von Akteuren und eine Umverteilung von Ressourcen hin zu innovativeren Banken erleben, die in der Lage sind, sich zu verjüngen. Dieses durch Umverteilung bedingte Wachstum wird sich positiv auf die Gesamtwirtschaft auswirken.
Digitale Finanzierungsplattformen sind auch in der Schweiz im Trend. 2021 wurden über Schweizer Plattformen Crowdfunding-Projekte mit 792 Millionen Franken finanziert, was einem Wachstum von 31 Prozent entspricht. Dies zeigt der aktuelle Crowdfunding-Monitor der Hochschule Luzern.
Seit der Gründung der ersten Crowdfunding-Plattform vor 14 Jahren wurden auf dem digitalen Weg in der Schweiz rund drei Milliarden Franken vermittelt. Verantwortlich für den jüngsten Anstieg sind Immobilienfinanzierungen. 142 Millionen flossen per Crowdlending und 418 Millionen per Crowdinvesting in Immobilien. Der Bereich deckt damit knapp drei Viertel des Gesamtvolumens ab.
Für Start-ups ist Crowdfunding allerdings nach wie vor von geringer Bedeutung. In diesem Bereich zählten die Studienautoren 35 Kampagnen aus dem Bereich «Technologie, Business, Start-up», die insgesamt 4,6 Millionen Franken generierten. Die Studie klammert allerdings internationale Plattformen wie Kickstarter aus, die sich etwa bei Schweizer Uhren-Start-ups grosser Beliebtheit erfreuen.
Im Bereich Crowdinvesting zählt die Studie für 2021 nur eine abgeschlossene Kampagne auf, diejenige der Challenger-Bank Neon, die 5 Millionen Franken einbrachte. Im Bereich Crowdlending entfielen gut 110 Millionen Franken auf die Kategorie Business. Gegenüber dem Vorjahr (CHF 95,9 Millionen), ist das Volumen in diesem Segment zwar wieder gestiegen, liegt aber noch deutlich unter dem Volumen von CHF 159,7 Millionen aus dem Jahr 2019.
Die HSLU-Studienautoren gehen davon aus, dass das Gesamtvolumen von Crowdfunding in der Schweiz in diesem Jahr auf über eine Milliarde Franken wachsen wird.
Glossar
Crowdfunding auf Deutsch auch Schwarmfinanzierung oder Gruppenfinanzierung, ist die bekannteste Art der alternativen Finanzierung. Mit dieser Methode der Geldbeschaffung lassen sich Projekte, Produkte, die Umsetzung von Geschäftsideen und vieles andere mit Eigenkapital oder dem Eigenkapital ähnlichen Mitteln versorgen.
Crowdlending bezeichnet über das Internet vermittelte Kredite, die von mehreren bzw. vielen Privatpersonen an andere Privatpersonen oder an Unternehmen gegeben werden.
Crowdinvesting ist eine Finanzierungsform, bei der sich zahlreiche Personen (Mikroinvestoren, Investoren, Anleger) mit typischerweise eher geringen Geldbeträgen über das Internet an zumeist jungen Unternehmen (Start-ups) beteiligen.
Text: Patrick Stämpfli
Bild: Reto Martin