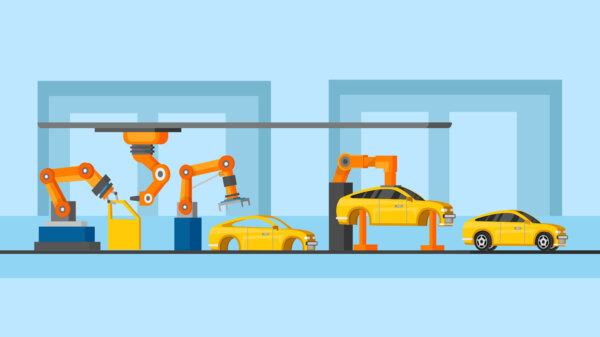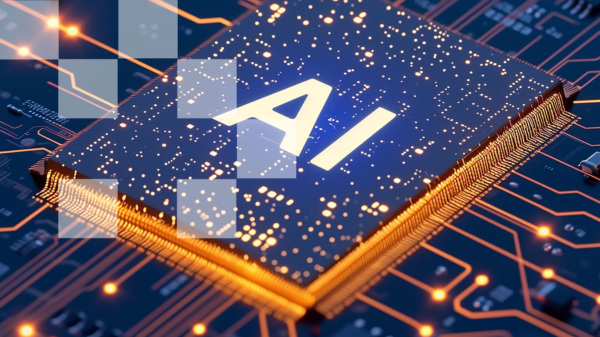Wider die überbordende Bürokratie in der Landwirtschaft

Wenn es um die Schweizer Landwirtschaft geht, sind schnell eine ganze Reihe von Klischees und Vorurteilen zur Hand. Unbestritten von der Branche wie auch von den Behörden ist der Umstand, dass die Agrarpolitik eigentlich viel zu detailliert und kompliziert ist – was zu einer überbordenden Bürokratie mit engmaschigen Kontrollen führt. Landwirte bekommen im heutigen System Direktzahlungen, wenn sie Vorschriften erfüllen; nicht beurteilt wird hingegen, ob die ursprünglich erhoffte Wirkung tatsächlich erzielt wird.
Hier setzt ein vom Bundesamt für Umwelt finanziertes Forschungs- und Entwicklungsprojekt an, an dem je rund zehn Betriebe im Kanton Thurgau (Landwirtschaft im Tal) und im Kanton Glarus (Berggebiete und Alpen) beteiligt sind. Stossrichtung: Die Bauern sollen wieder die Verantwortung für die Wirkung ihres Tuns tragen.
«Die Wirkung wollen wir durch mehr Beratung und weniger Kontrollen erreichen.»
Ungenutzte Potenziale
Das Pilotprojekt basiert auf einem Vorläuferprojekt in den Kantonen Thurgau und Glarus, das aufzeigte, dass auf den meisten Landwirtschaftsbetrieben ungenutzte Potenziale vorhanden sind, um sowohl die Umweltleistungen wie das Einkommen auf den Höfen zu verbessern. Die Minimierung der umweltschädlichen Produktionsmittel wie Futtermittel, Mineraldünger, Pestizide und Antibiotika bleibt ebenso ein Ziel wie die Beibehaltung einer hohen Netto-Produktion.
In der Landwirtschaft kommen weitestgehend Bundesvorschriften zum Tragen, deren Vollzug dann beim jeweiligen Kanton liegt. Der Bund hat den Ansatz des Pilotprojekts genehmigt: «Der Fokus ist ja nicht darauf angelegt, Regeln ausser Kraft zu setzen», erläutert Ueli Bleiker, Leiter des Thurgauer Landwirtschaftsamts. Vielmehr sollen Vorschriften, die für die angestrebte Förderung der Biodiversität wenig bringen, durch wirkungsvollere und einfachere Abmachungen ersetzt werden.
Das Deregulierungs-Pilotprojekt will also nicht die Ziele der bisherigen Landwirtschaftspolitik untergraben, das übergeordnete Ziel, die Biodiversität zu fördern, soll vielmehr gestärkt werden. Nur die Mittel und Wege ändern sich – das Projekt trägt den Namen 3V, was für «Vertrauen, Verantwortung und Vereinfachung» steht.
Beratung statt Kontrollen
Als einer von vielen Indikatoren für Biodiversität gilt, ob die Feldlerche, die von der Vogelwarte Sempach als potenziell gefährdet eingestuft wird, in offenen Kulturlandschaften brütet. Bisher mussten die Behörden auf Formularen mit Kontrollfragen vor Ort abchecken, ob ein Landwirt die formalen Kriterien erfüllt, um eine für die Feldlerche günstige Umgebung zu schaffen. Im Pilotprojekt läuft das radikal anders: «Wenn nach drei Jahren die Feldlerche brütet, hat der Landwirt erfüllt», sagt Ueli Bleiker. «Die Wirkung wollen wir durch mehr Beratung und weniger Kontrollen erreichen.» Also wird dem Bauern erläutert, was es braucht, um die Feldlerche willkommen zu heissen: Man muss ihr Möglichkeit zum Brüten am Boden bieten. Deshalb sollte in Weizenfeldern bei der Saat Streifen ausgespart werden, die von der Feldlerche als Landebahnen und Nistplätze genutzt werden. Im Mais wiederum wird eine Kleemischung eingesät. Diese Untersaat bietet der Feldlerche Deckung und damit Nistmöglichkeiten sowie Schutz vor Fressfeinden.
«Das Ziel, in der Schweiz eine nachhaltigere Nahrungsmittelproduktion zu erreichen, gilt nach wie vor, aber wir versuchen, freier darüber nachzudenken, wie wir die Ziele erreichen können», betont Ueli Bleiker und hat nicht nur die Landwirte im Auge: «Da müssen wir uns auch von Verwaltungsseite her hinterfragen.»
Zufriedene, motivierte Bauern
Das Pilotprojekt 3V wurde 2019 gestartet und läuft noch bis 2022. Bis dahin sollen Erkenntnisse vorliegen, wo Potenziale zur Vereinfach in der Agrarpolitik liegen. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass im Pilotprojekt tendenziell besonders motivierte Landwirte beteiligt sind, allfällige neue Verordnungen aber für alle Betriebe anwendbar sein müssen. Das Dickicht an Vorschriften auszulichten und ein gutes Kosten-Nutzenverhältnis anzustreben sei letztlich im Interesse der Steuerzahler, hält Ueli Bleiker fest.
Mit weniger Vorschriften, aber klaren Zielen steige nicht nur die Verantwortung der Landwirte, sondern auch ihre Zufriedenheit, weil sie flexibel und betriebsspezifisch handeln können, lautet eine der Thesen des Projektes. Heute geht es Bauern nicht anders als anderen KMU-Verantwortlichen: «Die zahlreichen, oft nicht genügend nachvollziehbaren, vorwiegend massnahmenorientierten Vorgaben haben ihre Motivation und ihr Verantwortungsgefühl beeinträchtigt», heisst es auf der Website des Projektes (projekt3v.ch).
Text: Philipp Landmark
Bild: Marlies Thurnheer