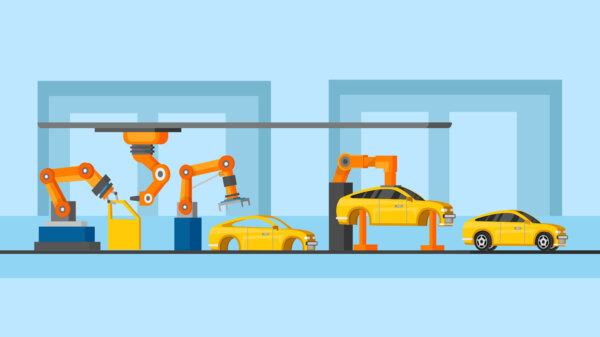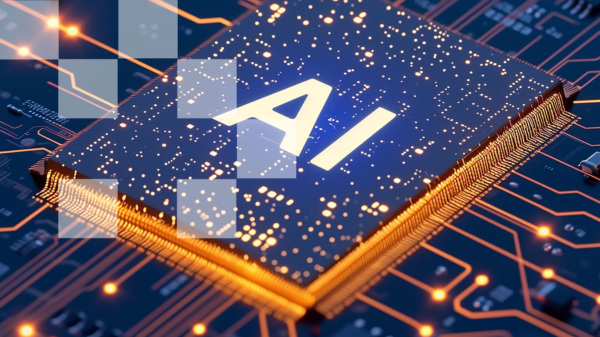Entrümpelung im Bundeshaus

Im Verlauf seiner Karriere hat Philipp Stähelin als Rechtsanwalt gewirkt und versucht, Gesetzestexte sinnvoll anzuwenden. Als Politiker und Top-Beamter wiederum hat er mit wechselndem Erfolg versucht, die Flut der Regulierungen etwas einzudämmen.
Kein nachvollziehbarer Inhalt
Philipp Stähelin war ab 1976 Thurgauer Staatsschreiber und hätte den alle paar Jahre fälligen Nachtrag für das seit 1948 bestehende Thurgauer Rechtsbuch in Angriff nehmen sollen. Also hat er sich die Sammlung des geltenden Rechts zu Gemüte geführt und kam zur Erkenntnis, dass es mit einem weiteren Nachtrag nicht getan sei. «Es war für niemanden mehr nachvollziehbar, was eigentlich noch gilt und was nicht», erinnert er sich.
Also reifte der Entschluss, ein neues Rechtsbuch in Form einer Loseblattsammlung in Angriff zu nehmen – und dabei die Gesetzessammlung auszudünnen. «Da waren noch Gesetze zurück bis ins Jahr 1803», erklärt Stähelin. Seit der Gründung des Kantons habe man wohl ab und zu ein Gesetz aufgehoben, «aber längst nicht alles». Deshalb wurde 1978 im Zuge des Projekts ein wegweisendes Gesetz erlassen, das dem neuen Rechtsbuch die sogenannte negative Rechtskraft gab. Das bedeutete: «Alles, was die Regierung damals ins Rechtsbuch aufgenommen hatte, war geltendes Recht. Und alles, was nicht aufgenommen wurde, wurde dadurch als ungültig erklärt.»
1000 Seiten Gesetze aufgehoben
Auf einen Streich wurden so rund 1000 Seiten Rechtsstoff aufgehoben. «Auch bei den einzelnen Erlassen haben wir nur noch das publiziert, was tatsächlich nötig war.» In vielen Erlassen habe es einzelne Abschnitte, Bestimmungen oder Paragrafen gehabt, die längst überholt waren. «Wir schmissen gewaltig viel raus – und nur wenige haben etwas davon vermisst. Alles ging gut über die Bühne.»
Stähelin wurde danach in den Regierungsrat gewählt und schliesslich vom Thurgauer Volk in den Ständerat delegiert. Dort erinnerte sich der spätere Präsident der CVP Schweiz bald einmal an die Erfahrung, dass man Rechtsstoff auch abschaffen könnte. Denn der Parlamentarier Stähelin sah: «Was da beim Bund ablief, war erschreckend.»
Kaum einmal wurden Gesetze aufgehoben, die Loseblattsammlung wurde stetig grösser. «Sie enthielt jede Menge Gesetze und Vorschriften, die eigentlich obsolet waren.» Philipp Stähelin formulierte deshalb einen Vorstoss, dass die Gesetzessammlung überarbeitet werde, alle obsoleten Erlasse seien zu streichen. «Die Motion wurde erheblich erklärt – aber die Umsetzung wurde nie angepackt.» Also doppelte Stähelin nach und ergänzte seine Forderung, dass nicht nur ganze Erlasse aufzuheben seien, sondern auch einzelne Abschnitte, sofern sie unnötig waren. Insgesamt drei Vorstösse unter dem Titel «Entrümpelung des Bundesrechts» reichte der Thurgauer Ständerat ein. «Wir wollen doch nicht einen Staat, indem nur noch ein ausgebildeter Anwalt versteht, was überhaupt noch gilt.»
Seine Vorstösse wurden erheblich erklärt, der Bundesrat hat das Anliegen jeweils auch unterstützt – aber nichts gemacht. «Das ist nicht aussergewöhnlich, das ist eben so», meint Philipp Stähelin in der Rückblende. Hingenommen hatte er das allerdings nicht: «Ich hatte damals entscheiden, in jeder Session einen Vorstoss zu formulieren, um irgendetwas aufzuheben – bis ich sehe, dass sich etwas bewegt.»
«Fertiger Blödsinn» als Gesetz
Lange musste er ja nicht suchen, um jeweils ein typisches Müsterli zu finden, «das war zum Teil fertiger Blödsinn, darum wurden die Vorstösse vom Bundesrat auch stets positiv beantwortet». Gestrichen wurde so etwa das Verbot der Verwendung von 125-Kilogramm-Säcken in Mühlen – eine Vorschrift, die mit dem Arbeitsalltag längst nichts mehr zu tun hatte, aber nie aufgehoben wurde. Für ein gewisses Aufsehen sorgte die von Stähelin initiierte Abschaffung der Velovignette, gegen die sich die Verwaltung heftig wehrte. Eigentlich, meint Jurist Stähelin, läge es ja an der Verwaltung, obsolete Erlasse zu erkennen und von sich aus den Auftrag zur Bereinigung zu geben. «Aber die Verwaltung hat kein grosses Interesse daran. Denn auch ein Gesetz, das man eigentlich aufheben könnte, beschäftigt mindestens noch einen Beamten», sagt Stähelin. Und für Politiker scheinen solche Entrümpelungsaktionen kein attraktives Betätigungsfeld zu sein, weil man damit «keinen Blumentopf gewinnt». Die steten Erinnerungen in Form von regelmässigen Vorstössen mit Absender Philipp Stähelin haben dem Bundesrat dann doch Beine gemacht. Schliesslich kam eine Vorlage, die die Forderung nach Entrümpelung aufnahm, «vieles wurde dann tatsächlich aufgehoben», stellt Stähelin zufrieden fest.
Schon im Thurgau wurde Philipp Stähelin klar, dass Staatsverträge des Kantons ein eigenes Feld sind, beim Bund sind sie es erst recht. Er stiess auf eine beachtliche Zahl an Niederlassungsverträgen der Schweiz mit anderen Staaten, beispielsweise mit dem alten Jugoslawien, die nachher von den Nachfolgestaaten übernommen wurden – «Verträge, die zum Teil besser waren als spätere Freihandelsabkommen», wie Stähelin betont. In den USA etwa hätte die Schweiz ein viel günstigeres Regime bei den Steuern gehabt, «aber diese Verträge gingen einfach vergessen».
Auch interessant
Verfalldatum für Gesetze
Wenn die Rechtssammlung des Bunds und das Staatsvertragsrecht episch lang werden und Vorschriften enthalten, die nie aufgehoben werden, «dann vergisst man sie einfach. Das ist eine gefährliche Entwicklung». Eine Möglichkeit, diese Entwicklung zu beeinflussen, wäre es, Gesetze und Verordnungen von Anfang an mit einem «Verfalldatum» zu versehen. Jedes Gesetz müsste nach einer bestimmten Anzahl Jahre vom Parlament erneut bestätigt werden muss, sonst tritt es ausser Kraft. Der Gesetzgeber müsste also regelmässig überprüfen, ob eine Vorschrift überhaupt noch notwendig ist.
«Auch ein Gesetz, das man aufheben könnte, beschäftigt mindestens noch einen Beamten.»
Aushebelung des Rechtsstaats
Sorgen macht dem Juristen der wachsende Bereich des sogenannten Soft Laws – Recht, das gar nicht vom eigentlichen Gesetzgeber erlassen wird. «Irgendwelche internationalen Konferenzen beschliessen etwas, das kommt bei uns aber nie vors Volk, weil es sich nicht um Gesetze oder Staatsverträge im eigentlichen Sinn handelt», sagt Stähelin. «Aber die Richter wenden das wie geltendes Recht an.» So entstünden Rechtssätze, die nie durch den regulären Prozess liefen, sondern an Konferenzen ausgedacht würden, an denen neben den Staaten zahlreiche Nichtregierungsorganisationen sitzen, «oft mit viel mehr Personal und Mitteln als kleine Staaten». Das sei eine Fehlentwicklung, «für den Bürger wird es viel schwieriger, nachzuvollziehen, was eigentlich noch gilt und was nicht», gibt Stähelin zu bedenken: «Der Rechtsstaat, so wie wir ihn kannten, wird ausgehebelt.»