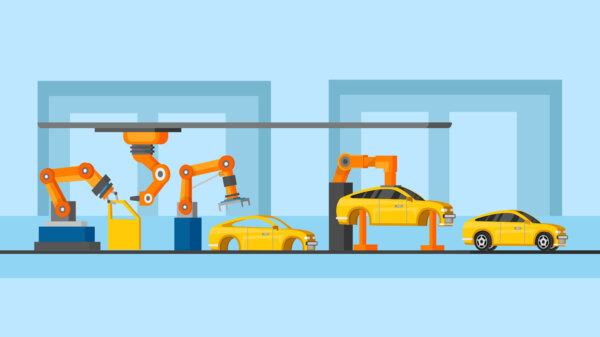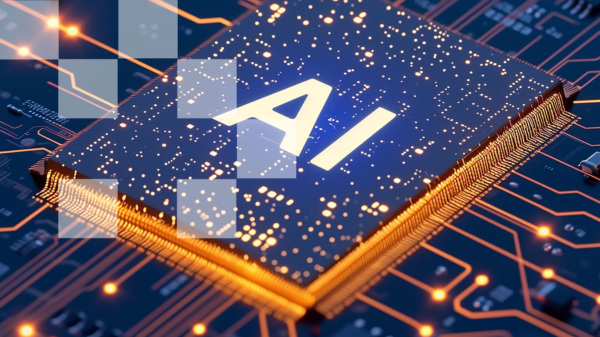Unsicherheit als Normalzustand

Die Zinssenkung der Nationalbank im März 2025 war ein Signal – aber kein Schock. «Die SNB-Zinssenkungen haben die Zinsen am kurzen Ende der Zinskurve gesenkt und damit zu einer Versteilung beigetragen», sagt Fredy Hasenmaile. Sollte der Franken weiter erstarken, die Inflation tiefer ausfallen als erwartet oder sich die Konjunktur merklich abkühlen, rechnet er mit weiteren Senkungen – möglicherweise bis nahe null. Auch René Zwicky zeigt sich wenig überrascht vom Entscheid: «Der Leitzins liegt inzwischen bei 0,25 Prozent. Das macht Saron-Hypotheken günstiger, ist aber für Sparer natürlich unvorteilhaft.»
Entscheidend werde sein, wie sich die Inflation entwickelt. Sollte sie weiter sinken, seien zusätzliche Schritte der SNB zu erwarten. Für Walter Ernst von der Hypo Vorarlberg ist es zwar aus Unternehmensicht positiv, dass die Senkung um 25 Basispunkte Investitionen begünstigt; er warnt aber gleichzeitig vor möglichen Übertreibungen am Immobilienmarkt. «Für Unternehmer und Bauinvestoren bedeutet das weiterhin Zugang zu ‹billigem› Geld.»
«Für Unternehmer und Bauinvestoren bedeutet das weiterhin Zugang zu ‹billigem› Geld.»
Lieber Saron- als Festhypothek?
Auch bei der Frage, ob aktuell eher Saron- oder Festhypotheken zu bevorzugen sind, herrscht weitgehende Einigkeit – allerdings mit Nuancen: Zwicky sieht klare Vorteile beim Saron-Modell: «In den kommenden zwölf Monaten sind steigende Leitzinsen kaum zu erwarten. Das spricht für Saron-Hypotheken.» Und Hasenmaile rät zur Vorsicht bei Festhypotheken: «Angesichts der Unsicherheit und der neuen US-Zollpolitik rechnen wir mit leicht sinkenden Kapitalmarktzinsen. Wer kann, sollte den Abschluss einer Festhypothek noch etwas aufschieben.» Ernst empfiehlt eine auf die individuelle Ausgangslage abgestimmte Aufteilung: «Wer über hohe Überschüsse verfügt, sollte eine grössere Saron-Tranche halten. Für den fixierten Teil warten wir gemeinsam Tiefpunkte ab – die Swapsätze schwanken derzeit stark.»
Die geopolitische Grosswetterlage sorgt für Nervosität an den Märkten. Insbesondere die steigenden Rüstungsausgaben werfen Fragen auf. Fredy Hasenmaile sieht darin durchaus zinssteigernde Effekte: «Höhere Staatsausgaben in Europa führen zu erhöhter Kapitalnachfrage und damit tendenziell zu steigenden Zinsen – auch wenn der Effekt in der Schweiz durch die globale Verflechtung abgeschwächt ist.» René Zwicky sieht es ähnlich: «Solange Rüstungsausgaben in die USA fliessen, bleibt der Einfluss auf Europa gering. Relevanter ist der deutsche Infrastrukturfonds – der könnte die Konjunktur in Deutschland stützen, was auch Schweizer Unternehmen hilft.» Walter Ernst sieht primär die wirtschaftspolitische Unsicherheit als problematisch. «Emotional berührt uns das Thema alle, ökonomisch ist der Effekt relativ klein. Viel relevanter sind die US-Zollpolitik und die Haltung der Fed.»
Die Mischung machts
Ein Handelskonflikt zwischen den USA und China oder der EU wäre laut Zwicky inflationär – «gleichzeitig könnte sich die Wirtschaft abschwächen. Derzeit sind die Auswirkungen schwer abschätzbar». Hasenmaile spricht gar von einer erratischen US-Politik, die Investitionen hemme und letztlich die Kapitalnachfrage schwäche – was wiederum auf die Zinsen drücke. Ernst stellt die entscheidende Frage: «Wie stark lässt sich die Fed künftig politisch beeinflussen?» Denn davon hänge ab, ob Inflation gezielt bekämpft oder zugelassen werde.
Für Unternehmen bedeutet das: Unsicherheit bleibt der Normalzustand. Ernst rät deshalb zu einer strukturierten Liquiditätsplanung: «Welche Mittel sind unverzichtbar? Diese sollten langfristig fixiert werden. Alles darüber hinaus kann flexibler gestaltet werden – aber mit Liquiditätsreserve.» Zwicky betont, dass die Schweiz trotz allem ein stabiler Markt sei: «Unsere Kurven sind stabiler als im Ausland – Zinsvolatilität ist hier kein zentrales Problem.» Und Hasenmaile ruft zu mehr strategischer Breite auf: «Diversifikation ist entscheidend. Unternehmen sollten ihre Finanzierungsquellen streuen und ihre Strategien auf mehrere Szenarien ausrichten.»
«Länger laufende Festzinsverträge sind für KMU mit kleinem Spielraum sinnvoll.»
Reserven nicht vergessen
Kleine und mittlere Unternehmen – das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft – sind besonders gefordert. Fredy Hasenmaile empfiehlt ihnen eine bewusste Laufzeitenstrategie: «Länger laufende Festzinsverträge sind für KMU mit kleinem Spielraum sinnvoll. Dazu eine Staffelung der Laufzeiten und gegebenenfalls Absicherungen über Zinsswaps.» Auch René Zwicky sieht Festkredite als sinnvolle Lösung, «abgestimmt auf die individuellen Ausgangslagen und Bedürfnisse». Und Walter Ernst weist mit Recht auf die Bedeutung von Reserven hin – nicht nur als Festgeld, sondern auch in Form von Aktien oder Gold. «Diversifikation, wie sie die SNB selbst vormacht, kann auch für KMU sinnvoll sein.»
Zum Schluss werfen alle drei Experten einen Blick in die Zukunft – wohl wissend, dass Prognosen immer mit Unsicherheiten behaftet sind. Zwicky geht davon aus, dass die Zinsen auf längere Sicht wieder leicht steigen werden, «hauptsächlich wegen der steigenden Staatsausgaben in Europa. Das wird sich auch auf die Schweiz auswirken». Hasenmaile sieht die Schweiz in einer komfortableren Position: «Die Inflation ist unter Kontrolle, das Vertrauen in die Nationalbank gross. Wir gehen davon aus, dass das aktuell tiefe Zinsniveau länger bestehen bleibt.» Ernst mahnt zu Realismus: «Zinsveränderungen kommen oft schnell und überraschend. Unternehmen sollten auch das Unwahrscheinliche mitdenken – aktuell sehen wir aber keine grossen Anstiege.»
Auch interessant
«In den kommenden zwölf Monaten sind steigende Leitzinsen kaum zu erwarten.»
Nicht nur Kreditgeber, sondern Sparringspartner
Neben dem Fachlichen zeigt sich im Gespräch mit den drei Bankexperten auch ein gemeinsames Bewusstsein für Verantwortung – nicht nur gegenüber Kunden, sondern auch gegenüber dem Standort Schweiz. «Unsere Aufgabe ist es, Orientierung zu geben – nicht mit Patentrezepten, sondern mit nachvollziehbaren Empfehlungen», sagt Fredy Hasenmaile. «Es geht darum, Kunden die nötige Sicherheit zu geben, um auch in unübersichtlichen Zeiten ruhig und planvoll handeln zu können», sieht das René Zwicky ähnlich. Und Walter Ernst schliesst: «Banken sind nicht nur Kreditgeber, sondern Sparringspartner. Wir müssen zuhören, mitdenken und manchmal auch unbequeme Fragen stellen.»
Eine Lehre aus den letzten Jahren ist, dass ökonomische Entwicklungen kaum mehr losgelöst von gesellschaftlichen und politischen Spannungen betrachtet werden können. «Was früher als klassische Konjunkturphase betrachtet wurde, ist heute von multiplen Einflussfaktoren durchdrungen – von Lieferketten bis geopolitische Blockbildungen», sagt Hasenmaile. Zwicky ergänzt: «Umso wichtiger wird eine klare, langfristige Strategie – auch wenn man diese laufend anpassen muss.» Dem pflichtet Ernst bei: «Wir dürfen nicht nur reagieren, sondern müssen vorausdenken. Wer das beherzigt, wird auch in stürmischen Zeiten Kurs halten.»
Wer sich also heute solide aufstellt, kann auch in einem unsicheren Zinsumfeld mit Stabilität und Weitblick punkten. Die Aussagen von Hasenmaile, Ernst und Zwicky zeigen, dass differenzierte Strategien gefragt sind – und Zukunftsorientierung mehr bedeutet als kurzfristige Zinsspekulation. Es geht um Substanz, Planung und Vertrauen – drei Begriffe, die in einem veränderten wirtschaftlichen Umfeld mehr zählen denn je.
Text: Stephan Ziegler
Bild: zVg