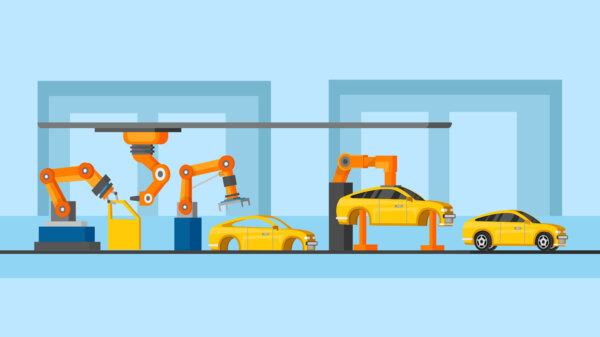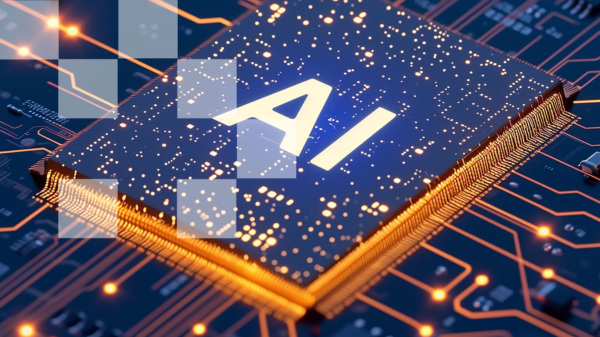Kultur hat eine ideelle Rendite

Welchen Nutzen hat eigentlich Kultur? Die Frage wird immer wieder gestellt, wenn die Politik Kulturförderbeiträge aus staatlichen Töpfen debattiert. Die Wirkung einer Subvention soll bitte möglichst genau ermittelt werden, indem der Return in Franken und Rappen beziffert wird. Liest man die einschlägigen Berichte der Ostschweizer Verwaltungen, dann wird der Return On Invest von Kultursubventionen ganz anders bewertet. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beispielsweise betrachtet die Sicherung einer kulturellen Grundversorgung als Service public. Eine wesentliche Aufgabe der Kulturförderung sei, «den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern».
Es sind also ideelle Werte, die mit Steuerfranken oder oft Geld aus dem Lotteriefonds alimentiert werden. Auch der Kanton St.Gallen formuliert als strategisches Handlungsfeld, dass Kulturförderinstrumente «mit besonderem Fokus auf die kulturelle Teilhabe in ihrer ganzen Breite, insbesondere mit Blick auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen» geprüft und angepasst würden, wie es im Jahresbericht 2021 des Amts für Kultur heisst.
Viele Nutzniesser von Förderung
In der Ostschweiz kommt ein dementsprechend breites Spektrum in den Genuss von Kulturförderung, keine Behörde will sich die Finger verbrennen, indem sie eine Kultursparte gänzlich links liegen lässt. Die Verteilung der Fördergelder ist aber höchst asymmetrisch. Der Kanton St.Gallen hat im letzten Jahr 77 Institutionen mit knapp 26 Millionen Franken unterstützt, 28 davon erhielten allerdings Beiträge von unter 10 000 Franken. Weitere 81 Projekte erhielten sechs Millionen aus dem Lotteriefonds.
Ein beträchtlicher Teil der Kulturförderung des Kantons St.Gallen geht an Konzert und Theater St.Gallen. 2018 wurden die Subventionen an den Betrieb im Hinblick auf die fast 50 Millionen Franken kostende Renovierung des Stadttheaters heftig diskutiert: Von den knapp 40 Millionen Betriebskosten stammen 28 Millionen von der öffentlichen Hand. Mehr als drei Millionen kommen von den Nachbarkantonen Thurgau und beiden Appenzell, über 8 Millionen aus der Stadt St.Gallen, der Rest vom Kanton. Die Eigenfinanzierung von 30 Prozent stammt je gut zur Hälfte aus Ticket-Erlösen (weniger als sechs Millionen) und aus Sponsoring und weiteren Einnahmen.
Das geht weit über die Grenzen der Kultur im engeren Sinn hinaus.
Der Kanton Thurgau unterstützt Konzert und Theater St.Gallen mit 1,6 Millionen aus Staatsrechnung. Der Grossteil der Thurgauer Kulturförderung wird über den Lotteriefonds finanziert, 4,3 Millionen waren dies 2021. Im Thurgau gibt es für kleine Projekte regionale Kulturförderpools: Beteiligen sich die Gemeinden an einem Projekt, zahlt auch der Kanton etwas daran, wie im Thurgauer Kulturkonzept für die nächsten vier Jahre festgehalten wird. Appenzell Ausserrhoden wiederum weist für die Vor-Corona-Jahre durchschnittlich 1,8 Millionen Kulturförderung aus. 62 Prozent davon sind gebundene Beiträge an Bibliotheken, Museen und Institutionen, 38 Prozent entfallen auf freie Projekte. Mit diesem Schlüssel könne man «angemessen auf die Entwicklung der Kulturlandschaft reagieren», heisst es im Kulturkonzept 2021 des Kantons. In Appenzell Innerrhoden kann die Standeskommission Beiträge aus dem Lotteriefonds sprechen, aus dem auch die Stiftung Pro Innerrhoden und die Innerrhoder Kunststiftung alimentiert werden, die einheimisches Kulturschaffen unterstützen.
Relevant ist die kulturelle Funktion
Kultur hat auch eine politische Funktion, sie kann Themen erkennen, Themen setzen. Natürlich gibt es Akteure, die bewusst provozieren und kalkulierte Aufreger produzieren – wenn der erste Politiker danach ruft, der betreffenden Institution die Subventionen zu streichen, wissen sie, dass sie gehört wurden. Wie viel staatliche Kulturförderung ist richtig? Klar ist: Ohne massive Unterstützung wäre Konzert und Theater St.Gallen undenkbar, obwohl die Häuser gut besucht sind. Umgekehrt generiert die Institution zahlreiche positive wirtschaftliche Effekte. Die meisten Angestellten, auch Musiker oder Schauspieler, wohnen in der Region und zahlen hier Steuern, die Besucher der Aufführungen nutzen auch umliegende gastronomische Angebote. Das sind angenehme Nebeneffekte, das darf aber nicht die Legitimation für eine Kultur-Institution sein, sagen sogar Ökonomen wie Roland Scherer, die solche Effekte berechnen. Eine Kultureinrichtung müsse in erster Linie über ihre kulturelle Funktion bewertet werden. Erfüllt also die Tonhalle St.Gallen die Funktion, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern? In Summe tut dies die Kultur ganz sicher. Wie wichtig diese Funktion ist, haben wir während der Pandemie gelernt, als diese Begegnungen plötzlich fehlten. Von der Künstlerin, die in einer privaten Galerie ausstellt, bis zur Oper im Stiftsbezirk, von der Stubete im Alpstein bis zu Europas grösstem Hip-Hop-Festival in Frauenfeld – überall bringt Kultur nicht nur Menschen zusammen, sondern auch in einen Austausch. Weil Kultur so ein wichtiger Kitt sei, müssten alle Menschen unserer Gesellschaft Zugang zu Kultur haben, nicht nur die gutverdienenden, ist Ann Katrin Cooper, die Präsidentin der IG Kultur Ost, überzeugt – und deshalb müsse Kultur auch subventioniert werden.
Auch interessant
Kultur zieht spannende Leute an
Die Qualität der Kultur hat auch mit der Dichte des Kulturangebots zu tun, die unterschiedlichen Milieus stehen in einem Austausch und befruchten sich gegenseitig. Das geht auch weit über die Grenzen der Kultur im engeren Sinn hinaus: Wo eine lebendige Kulturszene neue Ideen ausbrütet, finden sich auch spannende, kreative Köpfe, die innovative Ansätze in der Wirtschaft zu Fliegen bringen. Diesen Effekt um mehrere Ecken genau berechnen zu wollen, dürfte etwas waghalsig sein. Offensichtlich ist aber, ob sich an einem Ort gute Leute für kreative Jobs finden lassen. Und liegt dann der Schluss nahe: Kultur lohnt sich.
Text: Philipp Landmark