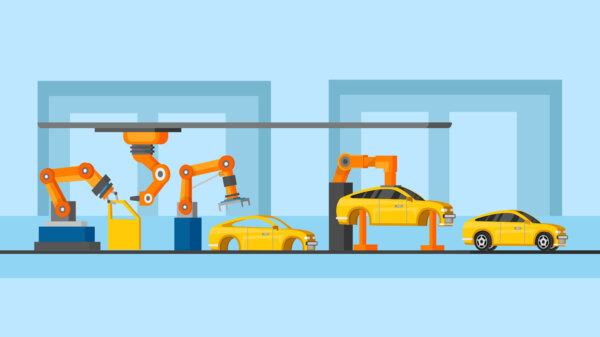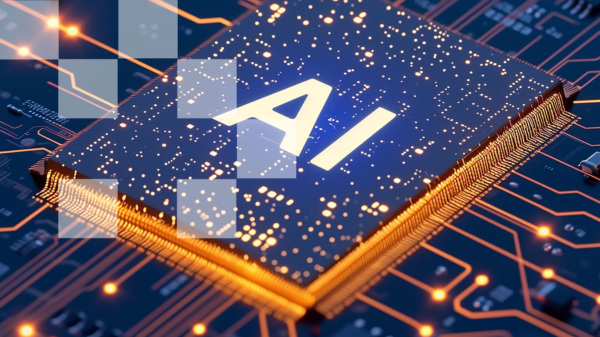«Kernfunktion der Kultur ist nicht die Wertschöpfung»

Als Direktor des Instituts für Systemisches Management und Public Governance an der HSG wird Roland Scherer immer wieder angefragt, wenn die wirtschaftlichen Effekte einer Kulturinstitution zu beziffern sind. Der Regionalökonom kann das, wie er vor einem Jahr mit einer Studie über potenzielle Effekte eines neuen Luzerner Theaters zeigte. Dabei galt es auch die Frage zu klären, in welcher Grössenordnung ein Theater-Neubau mit verändertem Programmkonzept Beiträge zur regionalen Wertschöpfung generieren könnte.
Wie kann Kultur Wertschöpfung generieren? Im Gespräch geht Roland Scherer erst einmal elegant über diese Frage hinweg und macht ein Statement, das man von einem Ökonomen so vielleicht nicht erwartet hätte: «Eine Kultureinrichtung muss zuerst über ihre kulturelle Funktion bewertet werden. Ob man eine Kultureinrichtung will oder nicht will, sie gut findet oder nicht gut findet, muss primär unter kulturellen Gesichtspunkten beurteilt werden.» Eine Kultureinrichtung habe zuerst einmal eine Kernfunktion, betont Roland Scherer, bei einem Theater sei dies, Theater auf die Bühne zu bringen. «Dafür braucht es eine gute Intendanz, eine gute Regie, ein gutes Ensemble, eine gute Ausstattung.» So könne ein gutes Programm gemacht werden. Gleichzeitig stehe ein Theater oder eine andere Kulturinstitution auch immer in einer Wechselwirkung mit der Standortregion. Zum einen gibt es ein kulturelles Angebot, das kann konservativ oder progressiv, langweilig oder attraktiv sein. Zum anderen entstehen durch dieses Angebot ökonomische Effekte – neben vielen anderen Effekten.
«Kultur hat den Anspruch, sich mit Neuem auseinanderzusetzen. Das färbt ab.»
Eine Daseins-Grundfunktion
«Ein Kulturangebot hat gewissermassen eine Daseins-Grundfunktion», sagt Roland Scherer, «es wirkt aber auch Image-bildend, sowohl positiv als auch negativ.» Die ökonomischen Auswirkungen eines Kulturangebots seien sehr unterschiedlich, je nachdem, wie ein Angebot ausgerichtet ist: «Spricht es neue Zielgruppen an, kommen deswegen auch Leute von ausserhalb hierher?» Gleichzeitig kann eine Kulturinstitution identitätsstiftend für den Standort sein. «Das sind alles Effekte, die man sehr differenziert betrachten muss», betont Scherer, «darum wehre ich mich dagegen, eine Kultureinrichtung nur über ihren monetären Beitrag zur regionalen Wertschöpfung zu bewerten.» Wenn ein Konzerthaus oder ein Kongresszentrum projektiert wird, stellt sich bald die Frage, wie viel zusätzliche Steuer- einnahmen und regionale Wertschöpfung mit einem Franken Subvention generiert wird. Das zu wissen sei sicherlich spannend, sagt Roland Scherer, der genau solche Berechnungen anstellt. Diese Aussagen aber als zentrale Legitimation zu verwenden, warum man eine Institution brauche, greift für den Ökonomen zu kurz. Denn die gesamten Wirkungen einer Kulturinstitution sind sehr vielfältig und lassen sich nicht rein auf die monetären Effekte reduzieren.
«Die Bregenzer Festspiele haben sicher eine andere Funktion für den Standort als eine Theaterbühne auf dem Dorfe», erklärt Roland Scherer, «die habe auch unterschiedliche Wirkungen, es entstehen unterschiedliche Effekte.» Aus den Festspielen ist in Bregenz im Laufe der Jahre ein Festspielhaus entstanden, das auch als Kongresshaus genutzt wird. «Das ist eine ähnliche Situation wie in Luzern mit dem KKL, dieses würde es heute nicht geben, wenn es nicht das Lucerne Festival gegeben hätte.»
Angebot auch für lokale Bevölkerung
Die Festspiele in Bregenz ziehen jedes Jahr mehrere 100 000 Besucher an und tragen den Namen Bregenz in die ganze Welt. «Die Festspiele mit ihrer internationalen Ausstrahlung hatten von Beginn an die Aufgabe, Gäste nach Vorarlberg zu bringen», sagt Roland Scherer, «ein Stadttheater hat eine ganz andere Funktion, es ist vor allem ein Kulturangebot für die lokale Bevölkerung.» Aufgrund der unterschiedlichen Funktionen von Kultureinrichtungen, ihrem unterschiedlichen Einzugsgebiet, aber auch aufgrund ihrer verschiedenen Betriebskonzepte, sind auch die wirtschaftlichen Effekte, die aus solch einer Einrichtung resultieren, sehr unterschiedlich. Und die Ergebnisse einer Einrichtung lassen sich deshalb meist nicht mit denen einer anderen Einrichtung seriös vergleichen.
«Ich wehre mich dagegen, eine Kultureinrichtung nur über ihren monetären Beitrag zur regionalen Wertschöpfung zu bewerten.»
Identitätsstiftender Event
Wenn in Einsiedeln alle sieben Jahre das Welttheater auf- geführt werde, sei das extrem identitätsstiftend, «Für die Menschen in Einsiedeln ist das Welttheater wichtig. Wenn die Ausschreibung kommt, melden sich umgehend mehrere hundert Personen, die als Statisten oder in sonst einer Funktion das Welttheater unterstützen.» Wenn auf dem Klosterplatz gespielt werde, sei der ganze Ort damit beschäftigt. Scherers Institut hatte auch für das eine Wertschöpfungsstudie gemacht, «da kommt schon einiges Geld nach Einsiedeln, trotzdem bleiben die Effekte überschaubar.» Dies ist unter anderem darin begründet, dass viele der Besucher aus der näheren und weiteren Region stammten und gleichzeitig auch die lokale Gastronomie und Hotellerie gar nicht auf die Verpflegung und Unterbringung von über 2600 Besuchern jeden Abend eingerichtet sind.
Ein regional-ökonomischer wirtschaftlicher Effekt entsteht dann, wenn Publikum von aussen angezogen wird – und die Menschen auch eine Chance bekommen, Geld auszugeben. «Spannend wird es, wenn ich kulturelle Aktivitäten in das touristische Angebot integrieren und eine Saisonverlängerung bewirken kann», meint Scherer und verweist auf das Beispiel des Arosa Humor Festivals: «Arosa kann dadurch seine Hauptsaison früher anfangen.»
Auch interessant
Kultur zieht kreative Menschen an
Ein wichtiger Effekt, der wissenschaftlich nachgewiesen, aber nicht in Franken und Rappen aufaddiert werden kann, ist der Einfluss des Kulturangebots auf die Kreativität der Wirtschaft. «Kultur hat den Anspruch, sich mit Neuem auseinanderzusetzen», sagt Roland Scherer. «Das färbt ab, um ein Theater, um eine Galerie, um eine Musikszene herum entstehen kreative Hotspots über die Kultur hinaus.» Viele wissenschaftliche Arbeiten würden aufzeigen, wie durch solche Wechselwirkungen eine kreative Klasse entstehe. Ein gutes kulturelles Angebot ziehe spannende Leute an, die sich inspirieren liessen. Deshalb habe es in Metropolitanräumen wie Berlin oder London auch in der Wirtschaft eine höhere Dichte an kreativen Leuten als in ländlich strukturierten Räumen. «In der Ökonomie geht man davon aus, dass die kreativen Menschen ein wichtiger Faktor für wirtschaftliche Entwicklung sind.» So hat der amerikanische Ökonom Richard Florida basierend auf dieser Grundannahme einen – wissenschaftlich nicht unumstrittenen – Kreativitäts-Index für Städte und Regionen geschaffen. Für ihn stand fest, dass jeder Mensch ein kreatives Potenzial habe, damit dieses sich entfalten könne, müsse ein Mensch aber in einem System leben, das diese Kreativität fördert. «Die Kultur beeinflusst sicher mit, wer in einem Ort wohnt», ist auch Roland Scherer überzeugt. Wenn ein kultureller Auftrag gut wahrgenommen werde, erhöhe das die Lebensqualität und die Identifikation mit einem Ort. «Das kann interessante Menschen anziehen.» Bregenz hat ein Kunsthaus von Peter Zumthor bauen lassen und stellt dort progressive Kunst aus. Nun kämen dort auch die entsprechenden Leute hin. «Und diese ziehen wieder entspreche Effekte nach sich.» Im Vorarlberg sehe man das beispielsweise in der progressiven Architektur.
«Kreative Menschen sind ein Faktor für wirtschaftliche Entwicklung.»
Bereicherung für die Region
Nicht nur Städte, auch kleine Orte können sich allenfalls überregional mit speziellen, hochstehenden Kultur-Events profilieren. Roland Scherer nennt «Bad Ragatz», das Freiluft-Skulpturenfestival in Bad Ragaz, als Beispiel. «Das ist ein wahnsinniger Erfolg, der Event erreicht viel Publikum auch von ausserhalb, weil es etwas Besonderes ist.» In städtischen Räumen findet sich aber oftmals ein anderes und grösseres Kulturangebot als im ländlichen Raum. Ein wissenschaftliches Erklärungsmodell dafür ist die sogenannte Zentrale Orte-Theorie, die man auf Schweizer Kantonshauptstädte ummünzen könne, sagt Roland Scherer: «In Zentren werden bestimmte Funktionen der Grundversorgung angeboten, von denen dann auch das Umland profitiert. Dazu gehört nun einmal ein Spital, eine Hochschule, aber eben auch ein Theater.» Der zusätzliche wirtschaftliche Effekt eines neuen Stadttheaters in Luzern wäre übrigens überschaubar, hat Roland Scherer zusammen mit Daniel Zwicker-Schwarm in der Studie ermittelt. Es wäre aber ein Bestandteil eines facettenreichen Kulturangebots, das wiederum einen grossen Beitrag an die Lebensqualität des Standorts leistet.
Text: Philipp Landmark
Bild: Marlies Thurnheer