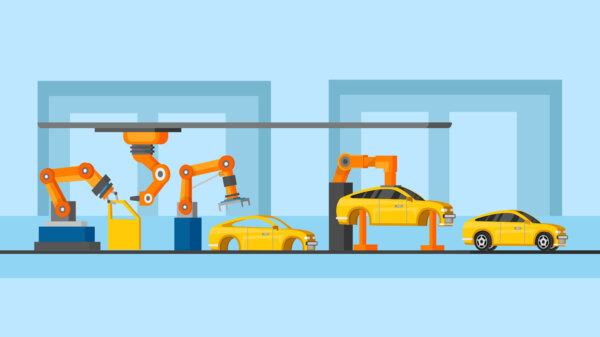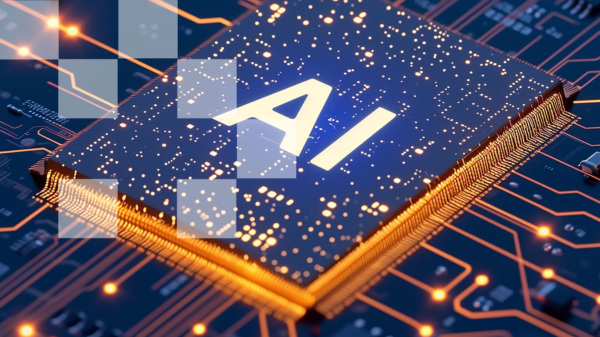Auf dem Weg zur Post-Corona-Mobilität

Der öffentliche Verkehr hat durch die Corona-Massnahmen starke Einbussen erlitten – gehen Sie davon aus, dass die Pendler mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen wieder vermehrt Bus und Bahn benutzen?
Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen: Ja, damit rechnen wir. Dies insbesondere in den Städten, denn dort ist das Parkplatzangebot beschränkt und Staus behindern das Vorwärtskommen. Allerdings erwarten wir, dass der Homeoffice-Anteil höher bleiben wird als vor der Pandemie. Zudem wird wahrscheinlich ein Teil des Geschäftsreiseverkehrs durch Videokonferenzen ersetzt. Dies könnte dazu führen, dass in den Spitzenzeiten weniger Reisende im ÖV, aber auch im MIV unterwegs sein werden.
Stefan Thalmann, Leiter Öffentlicher Verkehr des Kantons Thurgau: Das sehen wir genauso. Verkehrs- und klimapolitisch ist das eine positive Entwicklung, auch wenn sie für die Ertragsaussichten der ÖV-Unternehmen negativ ist.
Oliver Engler, Leiter Fachstelle öffentlicher Verkehr Appenzell Ausserrhoden: Das zeigt, dass es schwierig abzuschätzen ist, wie schnell sich die Frequenzen im ÖV erholen.
Ein Anreiz für Pendler ist die gute, schnelle Anbindung an Zentren, und hier vor allem an Zürich. Wie beurteilen Sie das aktuelle Angebot – und wie wird es weiter verbessert?
Marco Seydel, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr Appenzell Innerrhoden: Innerrhoden ist über Gossau und St.Gallen gut an das Fernverkehrsnetz und den Anschluss nach Zürich angebunden. Mit der bevorstehenden Beschleunigung des Schnellzugs Appenzell – St.Gallen auf gut 30 Minuten wird sich die Fahrzeit weiter verringern. Ein wichtiger Umsteigeort ist zudem seit jeher Gossau mit der Park&Ride-Anlage.
Engler, AR: Gute Anschlüsse an den Fernverkehr hat Herisau mit dem Viertelstunden-Takt Richtung St.Gallen und dem Halbstunden-Takt nach Gossau. Trogen und Speicher sowie Teufen, Bühler und Gais sind in St.Gallen über die Appenzeller Bahnen ebenfalls gut an das Fernverkehrsnetz angebunden. Und im Vorderland zentral ist der Busknoten Heiden mit Verbindungen in alle Richtungen. In den nächsten Jahren ist geplant, das ÖV-Angebot in Hauptverkehrszeiten zu verdichten, um die Attraktivität der Ausserrhoder Gemeinden als Wohn- und Arbeitsstandorte weiter zu erhöhen.
Thalmann, TG: Ausser der Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz sind alle Regionen unseres Kantons gut mit dem öffentlichen Verkehr an die Zentren Zürich, Winterthur, St.Gallen und Konstanz angebunden. Im Bahnausbauschritt 2035 erhalten Kreuzlingen, Konstanz, Amriswil und Romanshorn halbstündliche Direktverbindungen nach Zürich (heute stündlich). Ab Frauenfeld wird es dann zwei zusätzliche und schnellere Verbindungen pro Stunde nach Winterthur und Zürich geben. Ab Wil wird es eine zusätzliche und schnellere Verbindung nach Winterthur/Zürich und nach St.Gallen geben. Zwischen Arbon und St.Gallen wollen wir das Schnellbusangebot der Linie 201 schrittweise ausbauen. Für den übernächsten Bahnausbauschritt 2040 streben wir einen RegioExpress-Halbstundentakt zwischen Konstanz/Kreuzlingen und St.Gallen an (heute Stundentakt).
Ruggli, SG: Im Kanton St.Gallen liegen viele Arbeitsplätze ÖV-technisch oft nicht optimal. Verbesserungspotenzial sehen wir vor allem auf der Achse Wil–St.Gallen–Rheintal. Mit dem Halbstundentakt der Interregio-Züge im Rheintal ab Dezember 2024 und den Anpassungen am Busnetz verbessern wir das ÖV-Angebot aber stark. Nach dem Ausbau des Ostkopfs des Bahnhofs St.Gallen können auch hier die S-Bahnen dichter fahren (ab ca. 2028).
Ebenso wichtig ist die Erreichbarkeit von Hubs bzw. Zentren wie Frauenfeld, Herisau oder St.Gallen aus den jeweiligen Agglomerationen sowie den Randregionen.
Ruggli, SG: Die S-Bahn in der Agglomeration St.Gallen wird verdichtet. Das Angebot der Buslinien in die Zentren und ÖV-Drehscheiben wird parallel zur Nachfrageentwicklung stetig erweitert. Die Umsteigezeiten werden auf die Hauptverkehrsrichtungen optimiert. Wichtig sind Massnahmen zur Busbeschleunigung auf verstopften Strassen. Es geht darum, die Fahrzeiten der Busse zu reduzieren, die Pünktlichkeit zu erhöhen und Kosten zu sparen. Ein weiterer Schwerpunkt des Kantons St.Gallen ist der grenzüberschreitende ÖV. Das Potenzial ist kaum genutzt. Die Mängel liegen in den Tarifstrukturen, dem ungenügenden Kundenservice, dem wenig attraktiven Fahrplanangebot und den zum Teil fehlenden Infrastrukturen. Die Regierungen von St.Gallen und Vorarlberg haben in einer Absichtserklärung bekräftigt, die Situation stark zu verbessern.
Seydel, AI: Aufgrund der Fahrgastfrequenzen und des Nachfragepotenzials werden die Anschlüsse der Appenzeller Bahnen in St.Gallen, Herisau und Gossau priorisiert. Dies kommt Berufspendlern zwischen St.Gallen und Appenzell sowie dem touristischen Freizeitverkehr aus Gossau und Herisau in Richtung Alpstein zugute.
Thalmann, TG: Die Taktdichten unserer Buslinien in die Zentren und ÖV-Drehscheiben werden parallel zur Nachfrageentwicklung stetig erhöht. Die Umsteigezeiten werden auf die Hauptverkehrsrichtungen optimiert. Mit Busbeschleunigungsmassnahmen auf den Strassen werden die Pünktlichkeit erhöht und die Fahrzeit attraktiv gehalten.
Die Region St.Gallen-Bodensee will 80 Massnahmen mit einem Volumen von 130 Mio. Franken im Rahmen ihres Agglomerationsprogramms der 4. Generation von 2024 bis 2028 umsetzen. Was erhoffen Sie sich davon für Ihren Kanton?
Thalmann, TG: Für den öffentlichen Verkehr im Thurgau sind folgende Infrastrukturmassnahmen des 4. Agglomerationsprogramms St.Gallen – Bodensee wichtig: Verschiedene Umgestaltungen von Hauptstrassenachsen in der Stadt St.Gallen sollen unter anderem die Busverbindungen nach St.Gallen verbessern. Die Behebung von Schwachstellen im Fuss- und Velowegnetz sollen den kombinierten Verkehr Fuss-/Velo-/ÖV stärken. Zudem liefert das Agglomerationsprogramm die planerische Herleitung für Bahnangebots- und -infrastrukturausbauten, etwa für eine neue Bahnhaltestelle Romanshorn Hof-Salmsach oder den RE-Halbstundentakt Konstanz/Kreuzlingen – St.Gallen.
Ruggli, SG: Dazu kommt: Das Agglomerationsprogramm basiert auf einer optimal abgestimmten Raum- und Verkehrsplanung. Die kantonale Raumpolitik fordert die Verdichtung nach innen. 65 Prozent des Bevölkerungswachstums soll in den urbanen Verdichtungsräumen erfolgen. Dies führt zu mehr Verkehr auf mehr oder weniger der heutigen Infrastruktur. Das Agglomerationsprogramm sorgt dafür, dass sich die Siedlungs- und Arbeitsplatzgebiete an gut durch den ÖV erschlossenen Gebieten entwickeln.
Engler, AR: Ein zentrales Projekt für Appenzell Ausserrhoden wird mit Beiträgen aus dem Aggloprogramm der 3. Generation verwirklicht, nämlich die Entwicklung im Bahnhofareal Herisau inklusive Neugestaltung des Bahn- und des Bushofes. Das Schwergewicht im Aggloprogramm der 4. Generation liegt für Appenzell Ausserrhoden weniger in Infrastrukturausbauten, sondern in der Überarbeitung des ÖV-Konzepts der Agglo St.Gallen-Bodensee. Hauptziele sind dabei die Anpassung des ÖV-Busangebots an den Bahnausbau 2035 und die Ableitung von Massnahmen, die in die nachfolgenden Generationen des Agglomerationsprogramms einfliessen.
Seydel, AI: Der Kanton Appenzell Innerrhoden nimmt nicht am Aggloprogramm teil.
Auch interessant
Das Programm umfasst v. a. Schwerpunkte bei ÖV und Langsamverkehr. Wo bleiben dabei Strassen und Parkplätze?
Ruggli, SG: Stimmt – das Agglomerationsprogramm soll mit einer gut abgestimmten Raum- und Verkehrsplanung den Verkehr im dicht besiedelten Raum auf den Fuss-/Veloverkehr und den ÖV lenken. Die in der Hauptverkehrszeit mit nur 1,1 Personen ausgelasteten Autos benötigen zu viel Platz, der in den Agglomerationen nicht vorhanden ist. Die Verkehrsverlagerung erhöht die Effizienz des gesamten Verkehrssystems und reduziert den Stau auf den Strassen. Davon profitiert auch der MIV.
Thalmann, TG: Dem stimme ich zu hundert Prozent zu.
Engler, AR: Ja, auch der Strassenverkehr profitiert, da ein attraktiver und schneller ÖV mehr Fahrgäste auf Bahn und Bus bringen wird und damit Strassen und Parkplätzen entlastet werden.
Die einen sind überzeugt, dass sie nicht aufs Auto verzichten können, die anderen würden am liebsten alle in den ÖV und aufs Velo zwingen. Wie kann hier ein vernünftiges «Miteinander» entstehen?
Thalmann, TG: Es geht nur mit einer Gesamtverkehrsbetrachtung. Jedes Verkehrsmittel hat seine Stärken und Schwächen. Im dicht besiedelten Raum überwiegen aber die Nachteile des motorisierten Individualverkehrs klar.
Seydel, AI: In ländlichen und städtischen Regionen müssen nicht dieselben Mittel erfolgreich sein. Wichtig für Appenzell Innerrhoden sind insbesondere gut erschlossene Umsteigepunkte, beispielsweise mit Park&Ride-Anlagen.
Engler, AR: Zukünftig werden dank neuer Technologie (Smartphones mit Apps und Ortungsdiensten) vernetzte Mobilitätsangebote weiter zunehmen. Solche Mischformen von ÖV und MIV kombinieren die Vorteile von Auto, Velo, Taxi etc und öffentlichem Verkehr und wirken sich positiv auf die gesamte Reisekette aus. Ziel ist, dass sich die verschiedenen Verkehrsmittel ergänzen und weniger in Konkurrenz zueinanderstehen.
Ruggli, SG: Genau, bereits heute nutzen viele Menschen verschiedene Verkehrsmittel. Je nach Zweck oder Zeit ein anderes oder auf einem Weg mehrere.
Gerne werden gegen den Individualverkehr die Argumente «Lärm und Dreck» ins Feld geführt. Beide fallen mit der zunehmenden Elektrifizierung dahin. Wie richtet sich Ihr Kanton darauf aus, dass das Autofahren grüner und leiser wird?
Seydel, AI: Der ÖV als Kollektivtransportmittel schneidet gegenüber dem meist schlecht ausgelasteten Individualverkehr auch dann noch ökologisch besser ab, wenn ein Grossteil des motorisierten Individualverkehrs emissionsfrei fährt. Auch der Bau und Unterhalt von Strassen bindet enorme Energiemengen, weshalb das Klimaziel 2050 des Bundes (Netto-null-Treibhausgasemissionen) nicht nur mit Elektroautos erreicht werden kann.
Ruggli, SG: Der grösste Nachteil des Autos bleibt auch mit einem Elektromotor: Sie brauchen bei Gebrauch und Nichtgebrauch viel Platz. Beim Fahren beanspruchen sie eine viel grössere Fläche als Fussgänger oder Buspassagiere. Insbesondere, wenn nur eine Person mitfährt. Und ein Abstellplatz braucht ca. 15 m2 zuzüglich ManÖVrierfläche. Deshalb forciert der Kanton in den urbanen Gebieten den Fuss-Velo-Verkehr und den ÖV sowie die sinnvolle Kombination der geeignetsten Verkehrsmittel für die Reise.
Thalmann, TG: Korrekt! Um im ÖV die Emissionsvorteile beizubehalten, wird ja auch der Strassen-ÖV elektrifiziert. Der Handlungsdruck ist im ÖV aber wesentlich geringer als im motorisierten Individualverkehr.
Und wie wird dann das Verhältnis zwischen Individual- und öffentlichem Verkehr in Ihrem Kanton künftig aussehen?
Thalmann, TG: Das Gesamtverkehrssystem muss so weiterentwickelt werden, dass mit möglichst wenig Steuergeld und Umweltschäden alle Mobilitätsbedürfnisse befriedigt werden können.
Ruggli, SG: Dazu kommt: Die Nutzung von MIV und ÖV wird dank der Digitalisierung näher zusammenrücken.
Seydel AI: Appenzell Innerrhoden ist als ländlicher Kanton stark auf das Auto fokussiert. Dies wird auch mittelfristig so bleiben.
Engler, AR: Auch Appenzell Ausserrhoden ist ländlich geprägt und der Individualverkehr wird weiterhin eine grosse Bedeutung haben. Im nach St.Gallen (und weiter) ausgerichteten Pendlerverkehr hingegen spielt der ÖV mit seiner Taktdichte und guten Anschlüssen eine wichtige Rolle. Zusammen mit neuen vernetzten Mobilitätsformen sollte sich niemand übervorteilt fühlen.
Text: Text: Tanja Millius, Stephan Ziegler